
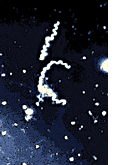
Geschichten der Vergangenheit oder Problem der Gegenwart?
Bekannt als englische oder auch französische Lustseuche war die Syphilis im Mittelalter eine gefürchtete Erkrankung,
die häufig zu geistigem Zerfall, Lähmungserscheinungen und nicht zuletzt zum Tode führte. Die erste 1497 von Leonicenus
beschriebene Luesepidemie reicht in das Jahr 1495 zurück. Sie betraf die Gegend um Neapel und breitete sich über sexuelle
Kontakte in rasender Geschwindigkeit über ganz Europa aus. Initial noch auf Seefahrer und Söldner beschränkt, machte der
so genannte harte Schanker durch die zunehmende Verstädterung auch vor namhaften Persönlichkeiten in allen
Gesellschaftsschichten keinen Halt. Erst mit der Entdeckung des Penicillins gelang es die Seuche weitgehend in den
Griff zu bekommen. So galt die Syphilis in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sogar schon als beinahe „ausgerottet”.
Doch zwischenzeitig registriert man wieder eine ansteigende Zahl von Neuinfektionen in der westlichen Welt. Heute zählt
die Syphilis zu den modernen Indikatorerkrankungen für sexuelle Risikobereitschaft und korreliert eindeutig mit
steigendenden HIV-Inzidenzen.
Vom Quecksilber über Salvarsan zum Penicillin
-
Bereits im Jahre 1564 beobachtete der Italiener Gabriele Fallopio Ulzerationen im Genitalbereich mit nachfolgenden
Hautausschlägen und empfahl beim Geschlechtsverkehr mit Quecksilber getränkte Leinenbeutel anzuwenden. Im Prinzip

| |
| Primäreffloreszenz der Syphilis: Die hautfarbene Papel. |
Es sollte noch etliche Jahrhunderte dauern, bis 1905 endlich der Syphilis-Erreger, der Spirochät Treponema pallidum,
isoliert wurde. Wenige Jahre später im Jahr 1909 wurde die Lues erfolgreich, aber mit teils schweren Nebenwirkungen
durch das von Paul Ehrlich eingesetzte Salvarsan behandelt. Die in verschiedenen Stadien verlaufende Erkrankung verlor
im vergangenen Jahrhundert durch die Verfügbarkeit von Penicillin ihre Schrecken. Frühzeitig eingesetzt führt das
Antibiotikum zur Restitutio ad integrum.
-
Gegenwärtig steigt die Zahl der gemeldeten sexuell übertragbaren Erkrankungen (STD) insgesamt wieder an, nachdem die
Meldungen zwischen 1990 und 2000 bereits rückläufig waren. Auch bei der Syphilis wurde im Jahr 2000 erstmals wieder
ein Anstieg der Neuinfektionen in der westlichen Welt registriert, nachdem deren Inzidenz seit 1941 erfreulicherweise
konstant gesunken war. Bemerkenswert ist, dass Deutschland die höchste Syphilisinzidenz in Westeuropa aufweist (2.8).
Bei Frauen ist das Auftreten von STD‘s zur Zeit noch regredient. Die rückläufigen Meldungen bei Frauen reflektieren
auch abnehmende Fallzahlen konnataler Syphilis, die zwischen 1989 und 1991 zunächst noch einen dramatischen Anstieg mit
häufig schweren Folgen aufwiesen. Unbehandelt führt eine Infek-tion mit Treponema pallidum in der Frühschwangerschaft
in bis zu 40% der Fälle zum intrauterinen Fruchttod. Bei einer einige Jahre vor der Schwangerschaft erworbenen
Lues latens seropositiva kommt es in mehr als 60% der Fälle zur Übertragung des Erregers auf das Ungeborene.
-
Neue statistische Erhebungen liefern erschreckende Daten über regelrechte Syphilis-Epidemien in großstädtischen
Ballungszentren wie z.B. San Francisco. Diesen folgt wenige Jahre später eine Zunahme der HIV-Infektionen. In einer

| ||||||
|
Primäraffekt bei einem Patienten mit HIV-Infekt.
| ||||||
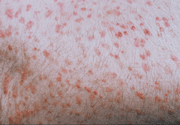
| ||||||
|
Papulosquamöses Syphilid.
| ||||||

| ||||||
|
Palmares Syphilid.
| ||||||

| ||||||
Clavi syphilitici.
|
| 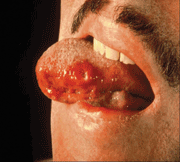
Syphilis: Primäraffekt.
|
| 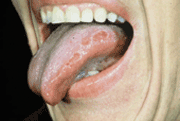
Plaques muqueuses.
|
| 
Angina specifica.
| |
In einem Bericht von Chaisson et al. (2003) konnte die immanente Rolle moderner Medien und der Telekommunikation für die Verbreitung sexuell übertragbarer Erkrankungen nachgewiesen werden. Im Rahmen einer anonymen Befragung ließ sich eindeutig belegen, dass via Internet die Möglichkeit besteht, schier unbegrenzt sexuelle Verabredungen zu treffen. Hierbei zeigte sich insbesondere unter HIV-positiven homosexuellen Männern eine signifikante Korrelation zwischen der Anzahl der online vereinbarten sexuellen Zusammenkünfte und der Häufigkeit von ungeschütztem analen Verkehr (UAV).
Problematischerweise wird ein negativer HIV-Test häufig als Sicherheitsgarantie für risikolosen ungeschützten Geschlechtsverkehr missverstanden, zumal die Behandlung von Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien und Trichomonaden medizinisch vermeintlich keine Herausforderung mehr darstellt. Dabei werden aber die zunehmend eintretenden Resistenzen nicht in Rechnung gestellt. Solche bestehen z.B. sogar bei den normalerweise problemlos behandelbaren Gonokokken. Auch das Zeitfenster bis zur diagnostizierbaren Serokonversion von HIV oder Hepatitis B und C stellt einen Risikofaktor dar.
Riskanterweise zeichnet sich ein Nachlassen der Angst vor HIV und AIDS ab. HIV gilt im Gegensatz zu den 80iger Jahren
heute als gut behandelbar. Rasche tödliche Verläufe werden nur noch selten beobachtet. Die Arbeitsgruppe um
Kalichman SC et al. (2001) publizierte eine Studie über die Risikoabschätzung des persönlichen Sexualverhaltens
bei HIV-positiven Patienten, in der sich die Vermutung bestätigte, dass Patienten mit Viruslasten unterhalb der
Nachweisgrenze eine erhöhte Risikobereitschaft zeigen. Grund hierfür war eine Fehleinschätzung des Transmissionsrisikos.
-
Auch in deutschen Großstädten zeigen sich Tendenzen zu vermehrter sexueller Risikobereitschaft, die sich unter anderem
in der steigenden Syphilis-Inzidenz ausdrückt. Galt die Syphilis in den 80iger Jahren als beinahe „ausgerottet“, zählt
sie heute zu den modernen Indikatorerkrankungen für sexuelle Risikobereitschaft und korreliert eindeutig mit der
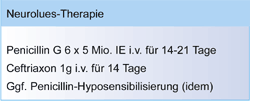 steigenden HIV-Inzidenz. In Deutschland werden aktuell 2.8 Erkrankungsfälle pro 100.000 Einwohner registriert. Vor
allem in Ballungszentren mit Zustrom aus dem osteuropäischem Ausland vervielfachten sich die Neuerkrankungen in den
vergangenen drei Jahren.
steigenden HIV-Inzidenz. In Deutschland werden aktuell 2.8 Erkrankungsfälle pro 100.000 Einwohner registriert. Vor
allem in Ballungszentren mit Zustrom aus dem osteuropäischem Ausland vervielfachten sich die Neuerkrankungen in den
vergangenen drei Jahren.
Die Transmissionsrate pro Risikosexualkontakt liegt bei den vorherrschenden Sexualerkrankungen (Syphilis, Gonorrhoe,
Chlamydien- und Trichomonaden-Infektionen) mit mehr als zwei Zehnerpotenzen ungleich höher, als die Gefahr eine
HIV-Infektion zu aquirieren. Dies beweist letztendlich, dass sowohl die Infektiosität als auch der Infektionsmodus
der jeweiligen STD zwar differieren, sich aber dennoch bei ansteigenden Syphilismeldungen auch entsprechend höhere
Inzidenzen bei HIV und Hepatitis C einstellen. Betrachtet man die Risikogruppen für HIV und Syphilis, so zeigen sich,
wie auch für andere sexuell übertragbare Erkrankungen, keine Unterschiede. Beachtenswert scheint, dass der
Zusammenhang – Zunahme der Syphilis-
-
Da die Infektanfälligkeit mit zunehmender Irritation bzw. Verletzung der Genitalschleimhaut steigt, hängt das
Transmissionsrisiko eindeutig von den angewandten Sexualpraktiken ab. Als genital ulzerierende Erkrankung erleichtert
der syphilitische Primäraffekt die Transmission weiterer Geschlechtserkrankungen wie Hepatitiden und HIV. Diese enge
Korrelation spiegelt sich auch in epidemiologischen Studien von Borisenko KK et al. (1999) und Albird R (2000) wider.
Erkrankungen, die zu genitalen Schleimhautläsionen führen, steigern das Infektionsrisiko für den HIV-negativen
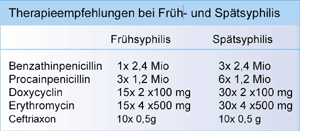 Geschlechtspartner. Bei guter Immunitätslage und niedriger Virusreplikation erhöht sich dieses Risiko um den
Faktor 2.6 (Ratio). Darüber hinaus wächst das Risiko exponentiell bis zum Faktor 27.7 (Ratio) an, wenn die
Viruslast über 38.500 Kopien/ml beträgt.
Geschlechtspartner. Bei guter Immunitätslage und niedriger Virusreplikation erhöht sich dieses Risiko um den
Faktor 2.6 (Ratio). Darüber hinaus wächst das Risiko exponentiell bis zum Faktor 27.7 (Ratio) an, wenn die
Viruslast über 38.500 Kopien/ml beträgt.
Von Valdisseri RO (2003) veröffentlichte Analysen zu syphilitischen Epidemien in amerikanischen Ballungszentren
haben ergeben, dass bei bis zu 59% der wissentlich HIV-positiven Männer unter antiretroviraler Therapie zeitgleich
eine Syphilis-
-
Die aus der Bandbreite sexuell übertragbarer Erkrankungen resultierenden Probleme stellen eine große Herausforderung
dar und machen entsprechende Präventionsstrategien nicht nur in dafür spezialisierten Zentren erforderlich. Vielmehr
müssen Vorsorge und Therapiemanagement auch in weiteren Gesundheitsbereichen thematisiert werden, um die
Transmissionsraten zu reduzieren, die Infektionsdauer zu verkürzen und Komplikationen bei Infizierten früh zu
erkennen und zu behandeln. Unsere Botschaft sollte sowohl via Internet als auch im Rahmen herkömmlicher Präventionsmaßnahmen
bei den einzelnen Risikogruppen ankommen: Der sicherste Weg, sich keine sexuell übertragbare Erkrankung zuzuziehen, ist
immer noch das Meiden unsicherer sexueller Kontakte.
Verfasser: N. H. Brockmeyer und B. Hochdorfer
Literatur bei den Verfassern.
Anschrift für die Verfasser: Prof. Dr. N.H. Brockmeyer,
Klinik für Dermatologie und Allergologie der Ruhr-Universität,
Gudrunstr. 56, 44791 Bochum,
E-Mail: n.brockmeyer@derma.de
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz
