

Zentrale Steuerung der Harnspeicherung und Harnentleerung
Die ohnehin sehr komplexe Koordination von Blasenspeicher- und Blasenentleerungsfunktionen wird zusätzlich
durch das soziale Verhalten beim Menschen kompliziert, da es gilt, zur Auslösung der Miktion eine geeignete
Gelegenheit abzupassen. Bei der Identifizierung der an der Miktionskontrolle beteiligten Hirnstrukturen sind
in den letzten Jahren durch den Einsatz moderner bildgebender Verfahren große Fortschritte gemacht worden.
Heute sind in nahezu allen Regionen des Gehirns Nervenzellansammlungen bekannt, die koordiniert zusammenwirken
müssen, um die Harnkontinenz zu gewährleisten. Diese Befunde tragen auch zum Verständnis der neurogenen
Detrusorhyperreflexie bei, denn als Folge neuronaler Erkrankungen wie dem Morbus Alzheimer, der Multiplen
Sklerose, der Parkinsonschen Erkrankung, Tumoren, einem Schlaganfall, Schädelhirntraumen und Rückenmarksverletzungen
kommt es nicht selten zur Harninkontinenz.
Die Motorik der Blase wird vom Pons aus kontrolliert
-
Bereits vor etwa 80 Jahren kam man aufgrund von Tierversuchen zu der Erkenntnis, dass die Kontrolle über die
motorischen Abläufe bei der Blasenentleerung im Hirnstamm von einem Zentrum innerhalb des Pons ausgeübt wird.
Viele Jahrzehnte später gelang es im dorsomedialen Teil des Pons eine Kerngruppe zu identifizieren (M-Region),
die über Nervenleitungen entlang der Seitenstränge des Rückenmarks mit dem sakralen Miktionszentrum in Verbindung
stehen.
Klinische Befunde und die Daten moderner Bildgebungsverfahren wie der Positronenemissionstomographie (PET) und der Einzelphotonenemissionscomputertomographie (SPECT) lassen den Schluss zu, dass auch beim Menschen ein pontinisches Miktionszentrum existiert [1, 2].
In lateraler Position befindet sich im Pons ein Kernbereich mit direkter Verbindung zum Onuf´schen Kern im Sakralmark, dessen inhibitorische Neuronen den urethralen Sphinkter geschlossen halten. Dieser bei Tieren als L-Region bezeichnete Nukleus hat offenbar auch ein Äquivalent im menschlichen Hirnstamm.
Gemäß neueren Modellen der Miktionskontrolle fungieren die beiden pontinischen Kerngebiete quasi als Gegenspieler:
Normalerweise ist die L-Region aktiviert, deren Wirkung auf den urethralen Sphinkter für Kontinenz zuständig ist.
Beim Umschalten auf die M-Region wird das koordinierte motorische Programm für die Miktion in Gang gesetzt.
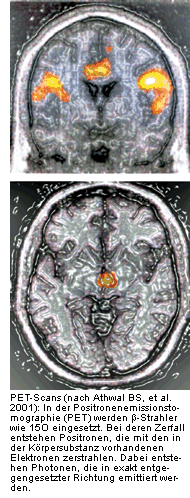
-
Weder das M- noch das L-Zentrum im Pons sind über Afferenzen direkt mit dem sakralen Rückenmark verbunden, so
dass ihnen keine unmittelbaren Information über den Füllungszustand der Blase zugehen. Die Projektionsfasern
aus dem Sakralmark erreichen Neuronen in der grauen Substanz, die den Aquäductus cerebri (Sylvii) umgibt
(zentrales Höhlengrau). Vom periaquäduktalen Grau bestehen Faserverbindungen zum Pons und zu etlichen Bezirken
im Vorderhirn.
Nach neueren Vorstellungen befindet sich im periaquäduktalen Grau eine Art Relaisstation, von der aus die
beiden pontinischen Zentren umgeschaltet werden. Die Entscheidung hierzu wird in dem verzweigten Netz von
Miktionszentren im Vorderhirn getroffen.
-
Anhand von Untersuchungen mit gesunden, katheterisierten, männlichen Probanden ließen sich mittels
PET-Scans Gehirnareale identifizieren, deren Aktivität sich während der Blasenfüllung ändert [3].
Der regionale Blutfluss im periaquäduktalen Grau nimmt während die Blase mit isotonischer Kochsalzlösung gefüllt wird deutlich zu. Dieser Befund war aufgrund der sensorischen Verbindung mit dem Sakralmark zu erwarten. Im Hirnstamm erhöht sich mit zunehmender Füllung der Blase auch die neuronale Aktivität im Pons.
Übergeordnete Zentren, die bei der Blasenfüllung mit gesteigerter Aktivität reagieren, befinden sich in den Gyri frontales, den Gyri cinguli und in der parietalen Rinde. Von diesen Gehirnregionen ist der vordere Frontallappen seit längerem als eine essentielle Instanz bei der Miktionskontrolle bekannt. Patienten mit Verletzungen in diesem Bereich leiden bekanntermaßen unter Blasenentleerungsstörungen.
Im Zusammenwirken mit weiteren Strukturen des Vorderhirns ist die präfrontale Rinde an der übergeordneten
Miktionskontrolle beteiligt [4]. Offenbar ist sie in den neuronalen Prozess eingebunden,
der darüber entscheidet, ob Zeit und Ort für eine Erleichterung der Blase geeignet erscheinen.
-
Als weiteres Ergebnis erbrachten die PET-Untersuchungen bei retrograder Füllung der Harnblase Einblicke in
die neuronalen Aktivitäten bei Harndrang. Insbesondere konnte nachgewiesen werden, dass Harndrang und die
Wahrnehmung des Füllungsgrades der Harnblase durch unterschiedliche Erregungsmuster im Gehirn gekennzeichnet
sind.
Steigt der Drang zur Entleerung der Harnblase, lassen sich nur Gehirnbereiche erkennen, in denen eine Deaktivierung stattfindet. Hierzu gehören der Kortex der Gyri cinguli, der prämotorische Kortex und der Hypothalamus.
Da die Wahrnehmung der Blasenfüllung und des Harndrangs voneinander unabhängig sind, erklärt sich auch aus
der Erfahrung des täglichen Lebens. Gesunde Menschen können ohne Probleme eine Zeit lang mit voller Blase
ausharren, wenn sich gerade keine Gelegenheit zur Entleerung ergibt. In einer stressigen Situation kann
Harndrang aber bereits bei geringem Füllungsgrad entstehen.
-
Vergleicht man bei normalen Männern die Aktivitäten des Gehirns während der Miktion mit dem Ruhezustand bei leerer Blase,
wird deutlich, dass ein ausgedehntes Netzwerk kortikaler und subkortikaler Regionen an der Koordination der Blasenentleerung
beteiligt ist [5]: PET-Scans zeigen einen erhöhten regionalen Blutfluss in Arealen nahe dem postzentralen
Gyrus, dem unteren frontalen Gyrus, dem Globus pallidus, im Mittelhirn, im Kleinhirnwurm und der Kleinhirnrinde. Zudem
werden etliche Gehirnbezirke unilateral aktiviert.
Untersuchungen an Männern und Frauen lassen in den gleichen pontinischen Regionen Aktivitäten während der Miktion
erkennen [1, 2]. Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden bezüglich des Blutflusses im rechten Gyrus
frontalis inferior registriert. Die Aktivitäten in dieser Gehirnregion sind bei Frauen während der Miktion deutlich schwächer
ausgeprägt [2]. Ferner sind Aktivitäten im periaquäduktalen Grau während der Miktion nur bei Männern
nachgewiesen worden. Darüber, ob bzw. inwieweit solche geschlechtspezifischen Aktivitätsmuster mit der unterschiedlichen
Ausprägung der Dranginkontinenz bei Männern und Frauen im Zusammenhang stehen, kann gegenwärtig nur spekuliert werden.
-
Literatur:
[1]Blok BFM, Willemsen ATM, Holstege G. 1997. A PET study on brain control of micturition in humans. Brain 120:111-121.
[2]Blok BFM, Sturms LM, Holstege G. 1998. Brain activation during micturition in women. Brain 121:2033-2042.
[3]Athwal BS, Berkley KJ, Hussain I. 2001. Brain responses to changes in bladder volume and urge to void in healthy men. Brain 124:369-377.
[4]Griffiths D. 1998. Clinical studies of cerebral and urinary tract function in elderly people with urinary incontinence. Behav Brain Res 92:151-156.
[5]Nour S, Svarer C, Kristensen JKI, Poulsen OB, Law I. 2000. Cerebral activation during micturition in normal men. Brain 123:781-789. Review:
Fowler CJ. 1999. Neurological disorders of micturition and their treatment. Brain 122:1213-1231.
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz
