

Akutdiagnostik Steintherapie Steinmetaphylaxe
Die Häufigkeit der Harnsteinleiden ist im Zunehmen begriffen. Darüber hinaus ist auch die Rezidivrate in den letzten beiden Jahrzenten angestiegen. In der Diagnostik der akuten Steinphase kommt heute den bildgebenden Verfahren die größte Bedeutung zu. Neben dem Harnsteinnachweis ermöglichen sie eine korrekte Indikationsstellung für das anzuwendende therapeutische Verfahren. Die Metaphylaxe ist in erster Linie aus medizinischer Sicht indiziert, denn rezidivierende Steine bergen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer arteriellen Hypertonie und von Nierenfunktionsstörungen. Aber auch nach Maßgabe ökonomischer Gesichtspunkte ist der Metaphylaxe ein hoher Stellenwert beizumessen.
Diagnostik der akuten Steinphase
-
In den Industrieländern wird seit einiger Zeit eine ansteigende Prävalenz des Steinleidens registriert.
Aus einigen Ländern – wie insbesondere Großbritannien und Portugal – wird zudem ein Rückgang des
Ersterkrankungsalters gemeldet. Das läßt sich in Deutschland wie auch den USA und Japan jedoch so
nicht bestätigen.
Anhand deutscher Daten wurde die Häufigkeit des Harnsteinleidens im Jahr 1979 mit der im Jahr 2000
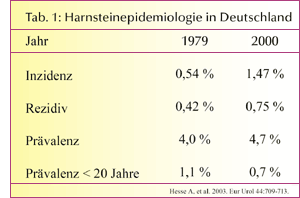
-
Die Harnsteindiagnostik dient in erster Linie dem Ausschluß bzw. der Bestätigung einer Verdachtsdiagnose
auf Harnsteine. Sollte ein Stein nachgewiesen werden, eignen sich die bildgebenden Verfahren zur korrekten
Indikationsstellung für die anzuwendende Therapie.
Als bildgebende Verfahren stehen die Sonographie, das konventionelle Röntgen und zunehmend auch die
Computertomographie (CT) zur Verfügung. Mit der Sonographie – einer durchaus zufriedenstellenden
Methode – lassen sich Nierensteine sowie proximale und auch prävesikale Harnleitersteine direkt
darstellen. Liegt ein erweitertes Nierenbeckenkelchsystem vor, ist das ein indirekter Hinweis auf
einen Stein. Sensitivität und Spezifität der Sonographie variieren je nach Lokalisation des Steins
sehr stark.
-
Das Ausscheidungsurogramm kann Hinweise auf die Steinlage und -größe geben. Zusätzlich lassen sich
Aussagen über die Funktion der Nieren machen. Ferner ist der Grad der Obstruktion recht gut zu
bestimmen. Bei extrem hoher Sensitivität variiert die Spezifität sehr stark. Mit etwa 1,5 mSv
ist die Strahlenbelastung relativ niedrig.
Das Nativ-CT gewinnt in der Notfalldiagnostik zunehmend an Bedeutung. Es ist eindeutig das
empfindlichste und spezifischste Verfahren. Voraussetzung ist allerdings, daß das Dünnschichtverfahren
gewählt wird, da sich die kleinen Steine ansonsten der Entdeckung entziehen können. Das CT hat einen
weiteren Vorteil: Wenn Hounsfield-
Die Strahlenbelastung ist beim CT ungleich höher als beim Ausscheidungsurogramm. Sie liegt zwischen
2,8 und 5,0 mSv. Daher wird in der Radiologie zum Teil auch das Ultraniedrigdosis-CT favorisiert.
Damit läßt sich die Strahlenbelastung der bei einem Ausscheidungsurogramm angleichen. Allerdings
leidet hierbei die Aussagefähigkeit des Verfahrens.
Bei einer Abwägung zwischen den einzelnen bildgebenden Verfahren ist dem CT die höchste Genauigkeit
zuzubilligen. Andererseits ist die konventionelle Diagnostik mit dem Ausscheidungsurogramm nicht so
viel schlechter. Strahlenbelastung, Kosten und auch die Verfügbarkeit sprechen – vor allem in der
Notfallsituation – für die konventionelle Röntgendiagnostik.
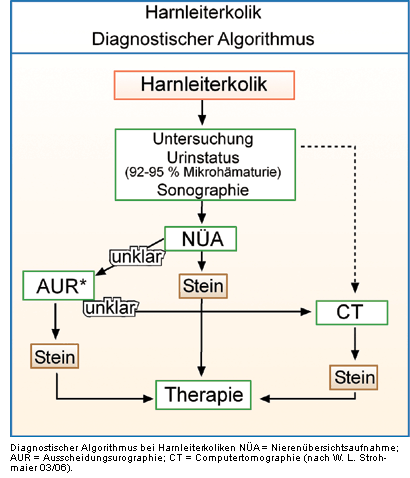
-
Weist der Befund auf einen Harnsäurestein hin, kann versucht werden, den Stein mit Hilfe von Medikamenten
aufzulösen. Bei Steinen etwa ab 20 mm Größe ist es empfehlenswert, aufgrund des Obstruktionsrisikos oder
bei nicht zu beherrschenden Koliken einen Doppel-J-Katheter einzulegen. Keine Möglichkeit der Chemolitholyse
besteht bei allen anderen als nicht abgangsfähig einzustufenden Steinen.
-
Die heutige Steintherapie beruht auf drei Säulen:
• ESWL
• Endoskopische Methoden
• Offenene Operation.
Bei kleinen Steinen steht die ESWL unangefochten an erster Stelle.
Von den endoskopischen Methoden kommen in der Niere die perkutane Nephrolithotomie und im Harnleiter in erster Linie die Ureterorenoskopie zum Einsatz. Insbesondere bei kleinen Unterpolsteinen spielt zunehmend auch die flexible Ureterorenoskopie eine Rolle.
Als Leitlinie für die Behandlung von Nierensteinen gilt: Je größer der Stein ist, um so eher wird man vorrangig ein endoskopisches Verfahren wählen, d.h. die perkutane Nephrolitholapaxie. In besonderen Situationen ist die flexible Ureterorenoskopie zu bevorzugen.
Die Schnittoperation ist heute nur noch Ausnahmefällen vorbehalten und spielt in der Klinik eine absolut untergeordnete Rolle.
Als besonders problematisch erweisen sich die unteren Kelchsteine, weil sie schlecht abgehen. Sie sind häufig der Ausgangspunkt für Rezidivwachstum. Bei den unteren Kelchsteinen wird heute – wenn die ESWL als nicht geeignet erachtet wird – zunehmend neben der perkutanen Nephrolithotomie auch die flexible Ureterorenoskopie angewandt. Mittlerweile gibt es auch minimal-invasive Geräte, die allerdings eine Laserlithotrip sie erfordern. Zudem bedarf es einer hydrophilen Schleuse, um mit dem flexiblen Gerät über den Harnleiter bis in den unteren Kelch zu gelangen. Dieses Verfahren setzt daher besondere Erfahrungen voraus.
Harnleitersteine werden entweder mittels ESWL oder mittels Ureteroskopie behandelt. Für die Wahl des
Verfahrens spielt zum einen die Lage, zum anderen die Steingröße eine Rolle. Bei den meisten unter
1 cm großen Steinen im proximalen Harnleiter gilt die ESWL als erste Wahl. Sind die Steine größer,
kommt die Ureteroskopie zum Einsatz. Bei den distalen Steinen wird immer öfter die Ureteroskopie
angewandt, weil sie sich mittlerweile zu einem wenig invasiven und sehr rasch zum Erfolg führenden
Verfahren entwickelt hat.
-
Die Metaphylaxe (Rezidivprophylaxe) wurde lange Zeit quasi zum Stiefkind degradiert. Doch in jüngerer
Zeit erlebt sie angesichts zunehmender Rezidive offenbar eine Renaissance.
-
Die Urolithiasis ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung einer arteriellen
Hypertonie. Wir wissen auch, daß Nierenfunktionsstörungen nicht selten vorkommen. Andererseits
kann man mit einer effektiven Metaphylaxe die Rezidivrate deutlich senken.
Daß Metaphylaxe nicht nur aus medizinischer Sicht höchst sinnvoll ist, sondern auch der Ökonomie dient, wurde vor einigen Jahren mit Hilfe einer großen Krankenkasse untersucht. Sie kann helfen, eine Menge Geld zu sparen, nicht zuletzt auch dadurch, daß die durch Steinepisoden bedingten Zeiten der Arbeitsunfähigkeit reduziert werden. Man kam auf eine Ersparnis von rund 500 Millionen Euro pro Jahr.
Die Leitlinien der European Association of Urology (EAU) und auch der Leitlinien-Entwurf der
Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU), dessen Endfassung beim nächsten DGU-Kongreß veröffentlicht
wird, gehen von Kategorien der Steinbildnern und der chemischen Steinzusammensetzung aus. Darüber
hinaus spielen individuelle Risikofaktoren für die jeweiligen Steinerkrankungen eine Rolle.
Hierbei werden die zugrundeliegenden Primärerkrankungen und der bisherige Verlauf der Steinerkrankung
berücksichtigt.
-
Inwiefern eine spezielle Metaphylaxe indiziert ist, entscheidet sich nach der Steinanalyse, der
Basisdiagnostik und der Einschätzung, ob Risikofaktoren vorliegen. Ist letzteres nicht der Fall,
reichen allgemeine Maßnahmen aus. Liegt aber ein hohes Risiko vor, bedarf es einer erweiterten
Diagnostik, auf die sich dann die spezielle Metaphylaxe stützt. Die Schlüsselrolle kommt hierbei
der Steinanalyse zu. Für diese Untersuchung eignet sich die Polarisationsmikroskopie in der Hand
des erfahrenen Mineralogen, die Röntgendiffraktometrie und die Infrarotspektroskopie. Obsolet sind
hingegen naßchemische Analysen, weil sie sehr häufig Fehler verursachen. Die Steinanalyse ist
deshalb von so großer Bedeutung, weil auf ihr das gesamte Gebäude der spezifischen Metaphylaxe
ruht.
Die wichtigsten Steinarten sind die Oxalatsteine, Phosphatsteine, Harnsäure- und Zystinsteine. Die Basisdiagnostik ist für alle Steinarten gleich und sollte bei allen Steinpatienten durchgeführt werden. Sie umfaßt die Anamnese, die körperliche Untersuchung, den Ultraschall, die Bestimmungen des Serumkreatinins, des Serumkalziums, der Harnsäure und einen Urinstatus mit den üblichen Parametern.
Jeder Steinpatient ist zunächst allgemein zu beraten. Es ist auf die Bedeutung einer hohen Diurese hinzuweisen, und darauf, daß die Flüssigkeitsmenge gleichmäßig über den Tag verteilt werden sollte. Die Ernährung sollte ausgewogen, ballaststoffreich, möglichst vegetabil sein. Zu den allgemein positiven Faktoren gehören oft auch eine Gewichtsreduktion, eine Streßreduktion und viel körperliche Bewegung.
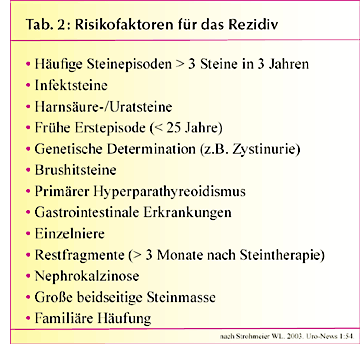
Kalziumoxalatsteinbildner: Die meisten Kalziumoxalatsteinbildner, insbesondere die Erststeinbildner, bedürfen keiner speziellen Untersuchung. Liegen Risikofaktoren vor, sind zusätzlich Blut- und Urinuntersuchungen angezeigt – unter Umständen auch die Bestimmung des Parat-hormons.
Die Gabe von Alkalizitrat spielt in der Metaphylaxe bei Kalziumoxalatsteinbildnern mit entsprechendem Risikoprofil die größte Rolle. Die Substanz ist sowohl bei Hyperkalziurie, bei Hypozitraturie als auch bei Hyper-urikosurie wirksam. Gibt es Hinweise für einen primären Hyperparathyreoidismus, sollte eine Nebenschilddrüsenexploration vorgenommen werden. Die seltene renale tubuläre Azidose bedarf einer Alkalizitrat- oder Bikarbonatbehandlung.
Die primäre Hyperoxalurie ist eine angeborene Erkrankung, die häufig bereits im Kindesalter zur Niereninsuffizienz führt. Sie kommt glücklicherweise relativ selten vor. Häufiger ist die enteral bedingte Hyperoxalurie, wie sie bei Morbus Crohn sowie verschiedenen anderen Dünndarm- und Pankreaserkrankungen auftritt. In diesen Fällen ist sogar bei Kalziumoxalatsteinen eine Supplementierung von Kalzium empfehlenswert.
Kalziumphosphatsteinbildner: Die Metaphylaxe bei Kalziumphosphatsteinen ist der bei Kalziumoxalatsteinen sehr ähnlich. Empfohlen wird eine Ernährungsumstellung, bei der insbesondere pro Tag nicht mehr als maximal 150 Gramm tierisches Eiweiß zu sich genommen werden sollte. Hingegen wird nicht empfohlen, generell die Kalziumzufuhr zu beschränken.
Infektsteinbildner: Eine Infektion mit ureasebildenden Bakterien ist Ursache für Magnesium-Ammoniumphosphat-Steine (Struvit). Bei ihnen reicht es aus, eine Basisuntersuchung vorzunehmen. Diese schließt die Antibiotikatestung, die Keimanzüchtung und pH-Tagesprofile ein. Eine effektive Rezidivprophylaxe bei Infektsteinbildnern setzt die komplette Steinsanierung voraus. Denn in diesen Steinen sind immer Keime enthalten, die durch Antibiotika nicht erreicht werden können. Ferner ist es notwendig, Harnabflußbehinderungen zu beseitigen und durch eine Langzeitantibiotikatherapie eine Keimeradikation zu bewirken. Als adjuvante Maßnahme empfiehlt sich eine Ansäuerung des Harns mit Methionin. Hierzu kann auch eine geeignete Ernährung beitragen.
Harnsäure- und Uratsteinbildner: Von diagnostischer Seite sind Urin-pH-Tagesprofile und die Bestimmung der Harnsäure im Sammelurin wichtig. Zur Metaphylaxe empfiehlt sich grundsätzlich eine purinarme Ernährung. Liegt eine Hyperurikämie bzw. Hyperurikosurie vor, ist die Gabe von Allopurinol sinnvoll. Die größte Bedeutung kommt aber der Harnalkalisierung zu. Hierfür sind Alkalizitrate oder auch bestimmte Mineralwassersorten geeignet.
Zystinsteine kommen zwar sehr selten vor, sind dann aber sehr hartnäckig. Für die Zystinbestimmung und die Erstellung von pH-Tagesprofilen wird Sammelurin benötigt. Wichtig ist, daß mindestens zwei Proben untersucht werden, da relativ große Schwankungen auftreten.
Die spezielle Metaphylaxe bei Zystinsteinbildnern beinhaltet Maßnahmen, die leider oft eine schlechte Compliance zur Folge haben: Die Diurese ist auf 3 bis 3,5 Liter auszudehnen. Der Harn muß extrem alkalisiert werden, um die Löslichkeit des Zystins zu verbessern. Vielfach wird zur Reduktion des Zystins zum leichter löslichen Zystein auch Ascorbinsäure gegeben. Allerdings verfehlt das bei größeren Mengen an Zystin seine Wirkung. Dann ist Tiopronin in körpergewichtsadaptierter Dosis indiziert. Die Ernährung sollte natriumarm sein.
Bei der Zystinsteinbildung handelt es sich um eine angeborene Krankheit, so daß bei der des öfteren
vorgeschlagenen Proteinrestriktion höchste Vorsicht geboten ist. Denn im Kindesalter darf die
Proteinzufuhr nicht eingeschränkt werden.
-
Nicht nur die Biochemie spielt bei der Steinentstehung eine wichtige Rolle. Gegenwärtig zeichnet
sich eine Entwicklung ab, bei der die Tubuluszelle des Nephrons wieder mehr im Mittelpunkt der
Steinpathogenese gesehen wird. Aus bereits sehr alten, aber auch aus neueren Arbeiten geht hervor,
daß die Kalziumoxalatübersättigung eben nicht mit der Anzahl und Wachstum der Steine korreliert.
Vielmehr spielt oxidativer Streß – wie er beim metabolischen Syndrom auftritt – eine sehr große Rolle.
Eine wichtige Rolle spielen die Hyperglykämie, Fettstoffwechselstörungen und renale
Blutzirkulationsstörungen. Diese bewirken Tubuluszellschäden, die häufig Ausgangspunkt
für die Steinbildung sind [2]. Allerdings sind diese Erkenntnisse – zumindest zur
Zeit noch – nur bedingt diagnostisch und therapeutisch nutzbar. In der urologischen Praxis muß man
sich gegenwärtig mit den sogenannten klassischen Risikofaktoren behelfen. Sie können aktiv angegangen
werden. Das bedingt insbesondere eine hohe Diurese und die Beeinflussung der steinbildenden bzw.
auch der inhibitorischen Substanzen im Urin.
-
Literatur:
[1] Hesse A, Brandle E, Wilbert D, et al. 2003. Study on the prevalence and incidence of urolithiasis in Germany comparing the years 1979 vs. 2000. Eur Urol 44:709-713.
[2] Manoharan M, Schwille PO. 2002. Oxypurines, protein, glucose and the functional state of blood vasculature are markers of renal calcium stone-forming processes? Observations in men with idiopathic recurrent calcium urolithiasis. Clin Chem Lab Med 40:266–277.
Nach dem Vortrag Nierensteine 2006 "Akutdiagnostik Steintherapie Steinmetaphylaxe" von Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Walter Ludwig Strohmaier, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, Klinikum Coburg auf dem Lilly-Forum, Interdisziplinäre Fortbildung, 2. Jahressymposium, Würzburg, 17. bis 19. März 2006
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz
