

Nierensteine als metabolische Störung und kardiovaskuläres Risiko
Nephrolithiasis wird heute weitgehend als renale Manifestation eines systemischen Krankheitsgeschehens begriffen. Sie tritt verbreitet in Verbindung mit dem metabolischen Syndrom auf, was auf die Beteiligung von Insulinresistenz an der Pathophysiologie von Steinkrankheiten hinweist. Harnsäuresteine bilden sich vorwiegend bei übermäßig saurem pH des Urins und unzureichender Pufferung mit Ammonium. Die Bildung von Kalziumoxalatsteinen bei Patienten mit metabolischem Syndrom ist indes durch Hypocitraturie gekennzeichnet. Alle Typen von Nierensteinen sind ein Risikofaktor für chronische Nierenkrankheit, durch die wiederum das Myokardinfarktrisiko erhöht ist. Bei Steinbildnern wurden deutlich erhöhte Inzidenzen von Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipositas, Myokardinfarkt und Apoplex beobachtet.
Nephrolithiasis ist eine in den westlichen Zivilisationen weit verbreitete Krankheit. Das Leiden wurde lange Zeit relativ einseitig hauptsächlich als Folge einer ungünstig veränderten Zusammensetzung der im Urin gelösten Ausscheidungssubstanzen verstanden. Epidemiologische Daten machen jedoch Zusammenhänge zwischen Nephrolithiasis und systemischen Funktionsstörungen wie kardiovaskulären Krankheiten und dem metabolischen Syndrom einschließlich seiner einzelnen Komponenten deutlich. Das führt dazu, dass Nephrolithiasis zunehmend als eine systemische Krankheit begriffen wird. Neuere Erkenntnisse sprechen zudem für eine wechselseitige Beeinflussung von Steinkrankheiten und anderen chronischen Erkrankungen. Hieraus entsteht für Urologen bei der Behandlung von Steinpatienten insbesondere im präventiven Bereich die Notwendigkeit, gegebenenfalls in interdisziplinärer Zusammenarbeit auch die kardiovaskuläre Risikobewertung mit zu berücksichtigen.
-
Die Inzidenz von Nierensteinkrankheiten, insbesondere aber die Anzahl der Rezidive hat in den letzten
Jahrzehnten deutlich zugenommen. Parallel dazu wurde ein nicht minder deutlicher Anstieg von Adipositas,
Diabetes mellitus Typ 2 bzw. des metabolischen Syndroms, das durch Insulinresistenz und einen Cluster von
Stoffwechselstörungen charakterisiert ist, beobachtet. Eine Reihe epidemiologischer Daten belegt den
Zusammenhang zwischen Nephrolithiasis und Adipositas, Diabetes mellitus und arterieller Hypertonie. Ihr
verbreitetes Vorkommen bei Nierensteinbildnern ist ein klares Indiz für eine Rolle in der Pathophysiologie
von Nephrolithiasis. Die Bildung von Harnsäuresteinen wird offenbar bei Diabetes begünstigt, während bei
Adipositas infolge vermehrter renaler Elimination von Kristallisationskeimen eher die Neigung zur Bildung
von Kalziumoxalatsteinen besteht [zitiert in 1].
Nephrolithiasis gilt als Prädiktor für die Entwicklung chronischer Nierenkrankheit. Diese steht wiederum
im Zusammenhang mit systemischen, metabolischen Deviationen. Diabetes mellitus und Hypertonie sind bei
Nierensteinpatienten mit chronischer Nierenkrankheit signifikant häufiger als bei Nierensteinpatienten
ohne chronische Nierenkrankheit. Darüber hinaus leiden sie häufiger unter Harnweginfektion und bilden
vermehrt Struvitsteine. In der breiten Bevölkerung sind Diabetes, Hypertonie und Kropfbildung vermehrt
bei Nierensteinpatienten mit chronischer Nierenkrankheit anzutreffen [zitiert in 2].
Unzureichende Versorgung mit Vitamin D bei Urolithiasis-Patienten
Weltweit lässt sich der zunehmende Trend zur Unterversorgung mit Vitamin D feststellen. Verbunden damit erhöht
sich das allgemeine Krebsrisiko, nimmt die kardiovaskuläre Mortalität zu und schreiten chronische Nierenkrankheiten
voran. Bei unzureichender Versorgung mit Vitamin D ist die Aufnahme von Kalzium und Phosphat im Darm gestört und
es kann sich ein Hyperparathyreoidismus entwickeln. Zudem wird vermutet, dass durch Vitamin-D-Mangel eine zugrunde
liegende Hyperkalziurie maskiert wird. In einer Pilotstudie mit 101 Steinpatienten hatten 81 (80%) einen
unzulänglichen Spiegel an 25-Hydroxyvitamin D, dem maßgeblichen funktionellen Indikator für den Vitamin-D-Status
beim Menschen. Im 24-Stundenurin der Steinpatienten mit unzureichendem Vitamin D fand sich bei 93% der Proben
zumindest ein anormaler Parameter, während das nur bei 40% der Patienten mit normalem Vitamin-D-Status der Fall
war. Am häufigsten wurde ein suboptimales Harnvolumen registriert (Abb. 1). Bemerkenswerterweise hatten 33% der
Patienten eine Hypokalziurie, d.h. die Kalziumausscheidung lag unter 100 mg/d [3].
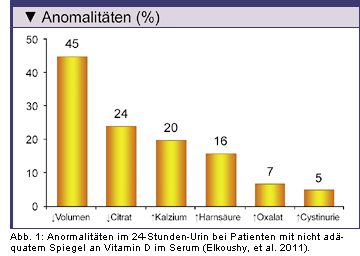
-
Harnsäure entsteht im Organismus hauptsächlich bei der Verstoffwechselung von Nukleinsäuren aus DNA und RNA sowie als
Abbauprodukt des Adenosintriphosphats (ATP). Aufgrund fehlender Urikase (Urat-oxidase) ist der Serum-Harnsäurespiegel
beim Menschen nur schlecht regulierbar, so dass er relativ hoch ist und ernährungsbedingten Einflüssen unterliegt. Zudem
findet sich eine beträchtliche Schwankungsbreite der Harnsäurespiegel im Serum, die sich meist zwischen 2,5 mg/dl und
12 mg/dl bewegt oder sogar darüber hinausgehen kann. Der Verlust des Enzyms Urikase bei Primaten wird entwicklungsgeschichtlich
auf Überlebensvorteile bei Nahrungsknappheit während globaler Kälteperioden im Miozen zurückgeführt. Im Gegenzug handelte
sich der Mensch durch gestiegene Serum-Harnsäurespiegel ein erhöhtes Risiko für Adipositas, das metabolische Syndrom,
Diabetes mellitus, Fettleber, Bluthochdruck sowie kardiovaskuläre und renale Krankheiten ein. Befunde jüngeren Datums
weisen auf eine Rolle der Harnsäure in der Pathologie vorgenannter Krankheiten hin [zitiert in 4].
Geringes Harnvolumen, Hyperurikosurie und niedriger pH des Urins spielen in der Pathophysiologie der Bildung von Harnsäuresteinen eine Rolle. Als maßgeblicher Pathomechanismus bei der Präzipitation von Harnsäure gilt aber ein zu saurer Urin, denn Hyperurikosurie führt im Allgemeinen nur bei niedrigem pH zu Nephrolithiasis [5]. Bei der Mehrzahl der Harnsäuresteinbildner wird im 24-Stunden-Urin ein pH <5,5 gemessen. Die Säureausscheidung im Urin ist das Produkt von Mechanismen, die zur Azidifizierung des Harns führen wie insbesondere der Na+/H+-Austausch, und Puffern, die Protonen neutralisieren wie Citrat, Phosphat, Kreatinin und Ammonium. Niedrige Konzentrationen dieser Puffer begünstigen die Kristallisation von Zystin und Harnsäure im Urin. Hierin liegt die Neigung zur Bildung von Harnsäuresteinen bei Patienten mit metabolischem Syndrom begründet. Diese Konstellation wie auch die bei Diabetes mellitus Typ 2 und Harnsäurenephrolithiasis ist durch Urin mit normalem Harnsäurespiegel bei niedrigem pH und einem deutlich abgesenkten Spiegel an Ammonium gekennzeichnet [6].
Strohmaier et al. (2011) untersuchten bei 167 aufeinander folgenden reinen Harnsäuresteinbildnern die Prävalenz verschiedener Komponenten des metabolischen Syndroms und ihre Bedeutung für den natürlichen Verlauf dieses Typs der Nierensteinkrankheit. Zahlreiche ihrer Patienten wiesen Übergewicht, arterielle Hypertonie und/oder Diabetes mellitus auf. In zwei Drittel der Fälle ließ sich anhand der Komponenten des metabolischen Syndroms ein Bezug zur Pathophysiologie der Harnsäuresteinbildung herstellen. Es fand sich eine signifikante positive Korrelation zwischen Body Mass Index (BMI) und der Harnstoffausscheidung, sowie eine negative Korrelation zwischen BMI und systolischem wie auch diastolischem Blutdruck. Hingegen stand der BMI in keinem signifikanten Zusammenhang mit urinärem pH, Citrat und Ammonium sowie auch nicht mit der Harnsäure im Urin und Serum. Bei zwei Dritteln der Patienten mit Harnsäuresteinen fand sich eine Hyperurikosurie mit übermäßiger Azidität. Hyperurikämie wurde bei 37% und eine verringerte Ausscheidung von Ammonium bei weniger als 25% der Patienten registriert. Keiner der ermittelten Parameter war mit der Anzahl der Steinepisoden signifikant korreliert. Die Schwere der Steinkrankheit wie auch die Rezidivneigung bleibt durch die metabolischen Störungen unbeeinflusst. Die Autoren folgern, dass das metabolische Syndrom kein prognostischer Faktor für Harnsäuresteinbildner sei [7].
Die Azidifizierung des Urins unterliegt einem zirkadianen Rhythmus. Hierfür sollen periodische Spitzen der Magensäuresekretion
verantwortlich sein. Zur Untersuchung des zirkadianen Musters der Azidifizierung des Urins erhielten zehn Harnsäuresteinbildner
und neun gesunde Probanden ein festgelegtes metabolisches Ernährungsregime. Die zirkadiane Azidifizierung wurde bei allen
Studienteilnehmern beobachtet. Allerdings wurde der Rhythmus in keinem Fall durch Inhibitoren der ventrikulären Protonenpumpen
beeinträchtigt. Harnsteinbildner und Kontrollen wiesen zwar ähnliche zirkadiane Muster der Azidifizierung auf, doch bei ersteren
war der Urin jederzeit stärker angesäuert. Die vermehrte Säureausscheidung bei Steinbildnern konnte in erster Linie auf titrierbare
Säure und in geringerem Maße auf Ammonium zurückzugeführt werden. Da zugleich die Eliminierung von Basen mit dem Urin bei
Harnsäresteinbildnern geringer war als bei den Kontrollen, ist davon auszugehen, dass die verstärkte Netto-Säureexposition
der Nieren bei vornehmlich nicht durch Ammonium bewirkter Pufferung mit einer erhöhten Konzentration an undissoziierter Harnsäure
und somit dem erhöhten Risiko zur Harnsäuresteinbildung verbunden ist [8].
-
Sakhaee et al. (2012) verglichen in zwei Studienkohorten (einer aus Dallas, Texas und einer aus Bern, Schweiz) den Einfluss des
metabolischen Syndroms auf die Bildung von Kalziumsteinen bei Patienten, die als Nicht-Steinbildner galten, und steinbildenden
Patienten, die wiederholt unter Kalziumsteinen litten: Bei ersteren lag die Menge des ausgeschiedenen Kalziums im Urin
zwischen 3,6 ± 1,8 und 6,0 ± 2,9 mmol/d, wobei die Menge mit der Anzahl von Komponenten des metabolischen Syndroms anstieg.
Parallel zu der Veränderung wurde eine signifikante Erhöhung der relativen Übersättigung (Supersaturation; RSS) des
Kalziumoxalats (CaOx) beobachtet (2,76 ± 1,21 zu 4,45 ± 1,65; p <0,0001; null bis vier Komponenten). Die Signifikanz blieb auch
nach Korrekturen für Harnvolumen, Alter, Geschlecht sowie Natrium und Sulfat im Urin bestehen. Bei den Kalziumsteinbildnern aus
Dallas stieg das Kalzium im Urin nur geringfügig mit der Anzahl der Komponenten des metabolischen Syndroms an. Nach Korrekturen
für Störfaktoren ergab sich auch für CaOx keine signifikante Erhöhung. Bei den Steinbildnern aus Bern wurde für das Kalzium
im Urin und der RSS CaOx keine Abhängigkeit von Stoffwechselparametern des metabolischen Syndroms festgestellt. Das Risiko für
die Bildung von CaOx-Steinen steigt demnach bei so genannten Nicht-
Steinbildnern mit der Anzahl der Komponenten des metabolischen Syndroms deutlich an, während die ohnehin erhöhte Neigung zu CaOx-Ausfällungen bei den Kalziumsteinbildnern vom metabolischen Syndrom unabhängig ist [9].
Niedriger Urin-Citratspiegel
Bei niedrigem Urin-Citratspiegel steigt die Neigung zur Präzipitation von Kalziumoxalat- und Kalziumphosphatsteinen. Denn durch
die verringerte Bildung von Kalziumcitrat erhöht sich das Risiko einer Übersättigung des Urins mit Kalziumoxalat und Kalziumphosphat.
Als erniedrigter Spiegel an Citrat im Urin gilt eine Menge von weniger als 500 mg im 24-Stundenurin. In der Mehrzahl der Fälle
ist Hypocitraturie idiopathisch. Andererseits wurden zahlreiche mögliche Ursachen identifiziert:
- Systemische Azidose,
- Renale Azidose,
- Harnweginfektion,
- Vitamin-D-Mangel,
- Chronische Diarrhoen,
- Ileostomie,
- Thiazid-induzierte Hypokaliämie und
- Glukokortikoidüberschuss.
Unter den Kalziumoxalat-Steinbildnern findet sich bei Frauen häufiger als bei Männern ein erniedrigter Spiegel an Citrat im Urin. Andererseits liegt der Urin-Citratspiegel bei nicht-steinbildenden Frauen höher als bei Männern (600 mg/l versus 400 mg/l), worin möglicherweise eine Erklärung für die insgesamt geringere Neigung zur Steinbildung bei Frauen zu suchen ist. Im Urin von steinbildenden und nicht steinbildenden Männern werden vergleichbare Citratspiegel vorgefunden. Ihre Höhe entspricht etwa der bei steinbildenden Frauen.
Eine Hypocitraturie kann durch mehrmaliges Einnehmen von Kaliumcitrat pro Tag korrigiert werden. Durch die vermehrte Ausscheidung
von Citrat lässt sich der Übersättigung des Urins mit Kalziumoxalat entgegenwirken und somit das Risiko der Bildung von
Kalziumoxalatsteinen verringern.
-
Eine Reihe epidemiologischer Daten belegt einen Zusammenhang zwischen Nephrolithiasis und systemischen Störungen wie Diabetes
mellitus Typ 2, Adipositas, Hypertonie bzw. deren Manifestation im Rahmen eines metabolischen Syndroms. Verschiedene dieser
Zusammenhänge gehen in beide Richtungen. Die Gründe für die Assoziationen sind noch nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich
sind Faktoren wie die Begünstigung eines der Steinbildung förderlichen Harnmilieus durch metabolische Reaktionen,
Ernährungseinflüsse, oxidativer Stress und Entzündung sowie molekulare Veränderungen, die den Molekültransport im Urin
beeinflussen, beteiligt [10]. Nierensteine sind ein Risikofaktor für chronische Nierenkrankheiten, die wiederum das
Myokardinfarktrisiko erhöhen. Unlängst wurde in Untersuchungen anhand größerer Bevölkerungsquerschnitte die Verbindung
von Nierensteinen zu einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten bestätigt.
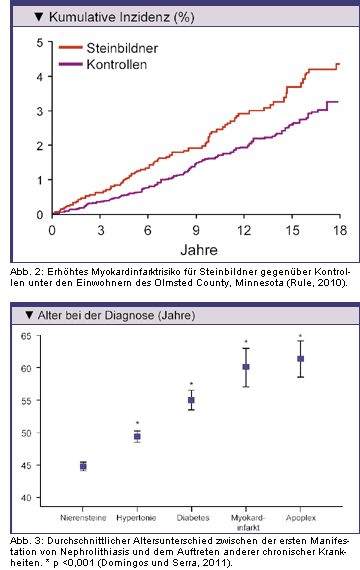
In der IV Portuguese National Health Survey standen für die Analyse möglicher Zusammenhänge zwischen Nephrolithiasis und
kardiovaskulären Krankheiten Daten aus 23.349 beantworteten Fragebögen zur Verfügung [1]. Die Prävalenz von Nierensteinkrankheiten
lag in der erwachsenen Bevölkerung bei 7,3%. Der Anteil adipöser Personen war unter den Steinbildnern 30% höher als unter
den Nicht-
Anhand von Daten aus der Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA)-Studie wurden weitere Indizien für die Ansicht
gewonnen, dass Nephrolithiasis und Atherosklerose gemeinsame systemische Risikofaktoren und/oder eine gemeinsame Pathophysiologie haben. Von
den 5.115 Teilnehmern der Studie im Alter zwischen 15 und 30 Jahren berichteten 3,9%, bereits mit Nierensteinen Bekanntschaft gemacht zu
haben. Bei symptomatischen Nierensteinen bestand ein signifikanter positiver Zusammenhang mit der Dicke der Carotiswand, der auch nach
Korrekturen für wesentliche atherosklerotische Risikofaktoren Bestand hatte [12].
[1] Domingos F, Serra A, 2011. Nephrolithiasis is associated with an increased prevalence of cardiovascular disease. Nephrol Dial Transplant 26:864-868.
[2] Cupisti A, 2011. Update on nephrolithiasis: beyond symptomatic urinary tract obstruction. J Nephrol 24:S25-S29.
[3] Elkoushy MA, Sabbagh R, Unikowsky B, Andonian S, 2011. Prevalence and metabolic abnormalities of vitamin D-inadequate patients presenting with urolithiasis to a tertiary stone clinic. Urology [Epub ahead of print].
[4] Johnson RJ, Lanaspa MA, Gaucher EA, 2011. Uric acid: a danger signal from the RNA world that may have a role in the epidemic of obesity, metabolic syndrome, and cardiorenal disease: evolutionary considerations. Sem Nephrol 31:394-399.
[5] Maalouf NM, 2011. Metabolic syndrome and the genesis of uric acid stones. J Ren Nutr 21:128-131.
[6] Wagner CA, Mohebbi N, 2010. Urinary pH and stone formation. J Nephrol 23:S165-S169.
[7] Strohmaier WL, Wrobel BM, Schubert G, 2011. Overweight, insulin resistance and blood pressure (parameters of the metabolic syndrome) in uric acid urolithiasis. Urol Res Aug 25. [Epub ahead of print].
[8] Cameron M, Maalouf NM, Poindexter J, et al. 2012. The diurnal variation in urine acidification differs between normal individuals and uric acid stone formers. Kidney Int Feb 1. [Epub ahead of print].
[9] Sakhaee K, Capolongo G, Maalouf NM, et al. 2012. Metabolic syndrome and the risk of calcium stones. Nephrol Dial Transplant Jan 13. [Epub ahead of print].
[10] Lange JN, Mufarrij PW, Wood KD, et al. 2012. The association of cardiovascular disease and metabolic syndrome with nephrolithiasis. Curr Opin Urol [Epub ahead of print].
[11] Rule AD, Roger VL, Melton III LJ, et al. 2010. Kidney stones associate with increased risk for myocardial infarction. J Am Soc Nephrol 21:1641-1644.
[12] Reiner AP, Kahn A, Eisner BH, et al. 2011. Kidney stones and subclinical atherosclerosis in young adults: the CARDIA sytudy. J Urol 185:920-925.
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz
