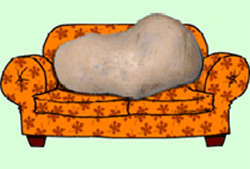Medizinrecht
Patientenrechte: Materielle Aufklärungsaspekte (II) – Eingriffsaufklärung
Nachdem zuletzt allgemeine Aspekte zur inhaltlichen Seite der Patientenaufklärung zur Sprache gekommen sind, geht es in den folgenden Überlegungen um die sog. Eingriffsaufklärung.
II. Materielle Aufklärungsaspekte
Wenn man sich materiellen Aufklärungsaspekten annimmt, ist im Ausgangspunkt zu konstatieren, dass § 630e Abs. 1 BGB – sozusagen – deren essentialia negotii als Minimum an aufklärungspflichtigen Informationen normiert. Abschließend ist sein Katalog aber keinesfalls („insbesondere“). Vielmehr kann es im Einzelfall „erforderlich sein, über weitere Umstände aufzuklären.“ Im Ausgangspunkt gilt schließlich, „dass sich die Art und Weise sowie Umfang und Intensität der Aufklärung nach der jeweiligen Behandlungssituation richten“ muss [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24]. Einmal mehr gilt der von Juristen geliebte und von Ärzten eher gefürchtete Satz: Es kommt drauf an. Damit könnte man im Grunde mit Ausführungen zu materiellen Aufklärungsaspekten enden. Etwas mehr an juristischer Aufklärung soll aber schon noch kommen.
1. Selbstbestimmungsaufklärung
§ 630e BGB regelt – nach seiner gesetzgeberischen Begründung [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24] – den „Anspruch des Patienten gegen seinen Behandelnden auf eine angemessene Aufklärung über die Tragweite, die Chancen und die Gefahren der medizinischen Maßnahme“ und damit korrespondierend die „Pflicht des Behandelnden zur sogenannten Eingriffs- und Risikoaufklärung (Selbstbestimmungsaufklärung).“ Dabei verdeutlicht der Klammerzusatz, dass es sich bei der Selbstbestimmungsaufklärung selbst nicht um einen isolierten Aufklärungsaspekt handelt. Vielmehr werden unter diesen Oberbegriff die einzelnen Aufklärungsarten vereint und erst deren Summe macht – gleichsam als deren Ziel – eine korrekte Selbstbestimmungsaufklärung aus.
Sinn und Zweck der Selbstbestimmungsaufklärung besteht wiederum darin, dem Patienten die Schwere und Tragweite eines etwaigen Eingriffs zu verdeutlichen, damit er eine ausreichende Entscheidungsgrundlage für die Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts erhält. Dabei obliegt es Ärzten aber nicht, medizinisches Detailwissen zu vermitteln [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24]. Dies entspricht der Rechtsprechung, wonach der Patient nicht exakt in einem medizinischen Sinne informiert werden muss, nach der Aufklärung aber jedenfalls „im Großen und Ganzen“ wissen muss, worin er einwilligt [BGH, Beschl. vom 16. August 2022 – Az.: VI ZR 342/21]. Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Vorbemerkungen kann sich nunmehr Fragen der Eingriffsaufklärung zugewandt werden. Wenn dabei – und demnächst bei der Risikoaufklärung – zuvörderst Entscheidungen zu anderen medizinischen Fachdisziplinen zur Sprache kommen, ist es unschädlich, weil jedenfalls das juristische Haftungsregime identisch ist und die Entscheidungen damit entsprechend übertragbar sind.
2. Eingriffsaufklärung
Gemäß § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB sind Ärzte verpflichtet, Patienten über „Art, Umfang, Durchführung […] der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie“ aufzuklären. Für diesen Part der Selbstbestimmungsaufklärung hat sich der Begriff der Eingriffsaufklärung etabliert. Wenn anderenorts von Verlaufs-, Behandlungs-, Therapie- oder Methodenaufklärung die Rede ist, verbergen sich dahinter keinesfalls sachliche, sondern bloß semantische Unterschiede.
Unabhängig davon ist es für Ärzte im Grunde aber gleichgültig, weil sie in jedem Falle lege artis aufklären müssen und wollen, ohne dass es dabei für sie ex ante von Relevanz ist, ob sie gerade §630e BGB oder §630c BGB erfüllen bzw. in welchem normativen (Stufen-)Verhältnis beide Vorschriften zueinander stehen. Der genaue juristische Unterschied zeigt sich im Grunde erst ex post, und zwar im Arzthaftungsprozess, weil die Beweisregel des §630h Abs. 2 Satz 1 BGB expressis verbis bloß an §630e BGB, nicht aber an §630c BGB anknüpft, der dagegen eher mit der Beweislastumkehr gemäß §630h Abs. 5 BGB wegen groben Behandlungsfehlers in Verbindung gebracht wird (Stichwort von der therapeutischen Sicherungsaufklärung). Prozessuale Aufklärungsaspekte sind freilich ein Thema für sich, auf das nicht an dieser Stelle, vielleicht aber zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen werden kann. Im weiteren Verlauf steht jedenfalls ausschließlich §630e BGB im Mittelpunkt.
Ebenso wenig soll §630c Abs. 3 BGB zur Sprache kommen: Er regelt die sog. wirtschaftliche bzw. ökonomische Aufklärung, nach der Patienten zu offenbaren ist, dass und wenn sie die Kosten der Behandlung selbst tragen müssen. Die Verletzung dieser wirtschaftlichen Aufklärungspflicht stellt aber nicht in Abrede, dass bei im Übrigen einwandfreier Aufklärung ein wirksamer informed consent vorliegt. Es zeigt sich darin, dass §630d Abs. 2 BGB die Wirksamkeit der Patienteneinwilligung nicht von §630c BGB abhängig macht, sondern vielmehr davon, „dass der Patient […] vor der Einwilligung nach Maßgabe von §630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.“ Daran knüpft der BGH an, wenn er urteilt, dass der Patient nach allgemeinen Grundsätzen die Beweislast dafür trägt, dass er sich bei ordnungsgemäßer Information über die voraussichtlichen Behandlungskosten gegen die in Rede stehende medizinische Behandlung entschieden hätte, ohne dass es insofern zu einer Beweislastumkehr zu seinen Gunsten kommt [BGH, Urt. vom 28. Januar 2020 – Az.: VI ZR 92/19]. Damit steht, soweit es um materielle Aufklärungsaspekte geht, zuvörderst §630e Abs. 1 BGB im Fokus des (weiteren) Interesses, das aber erst in der nächsten Folge gestillt wird.
a) Inhalt
Am Beginn der Eingriffsaufklärung steht dabei die Information über die Diagnose. Dabei obliegt es Ärzten aber nicht, medizinisches Detailwissen zu vermitteln. Ganz im Gegenteil: Die Aufklärung hat für den Patienten verständlich zu sein. Das gilt ebenso für „Art, Umfang, Durchführung“ der Maßnahme. Bei Krebs-Patienten mag ein erhöhter Aufklärungsbedarf über den Umfang der Chemotherapie bestehen. Bei operativen Eingriffen wiederum wollen Patienten sicher wissen, ob sie unter Voll- oder Teilnarkose erfolgen. Solche Informationen muss der Arzt von sich aus preisgeben und zur Risikoaufklärung kommen wir noch. Weitere Details zum medizinischen Inhalt der Behandlungsmethode müssen dagegen sicher Medizinstudenten interessieren, nicht aber zwangsläufig Patienten. Deren Interessen sind insofern bereits dadurch gewahrt, dass der Arzt nicht bloß lege artis aufklären muss, sondern zuvörderst lege artis behandeln muss. Wenn er es nicht tut, wird der Behandlungsfehler übrigens nicht durch eine korrekte Aufklärung legitimiert bzw. kompensiert. Darin liegt der tiefere Grund dafür, dass sich Ärzte, solange Patienten nicht explizit (nach-)fragen, bezüglich „Art, Umfang, Durchführung“ der Maßnahme eher kurzfassen können.
Essentialia negotii der Eingriffsaufklärung sind dagegen „Notwendigkeit und Dringlichkeit“ der geplanten Maßnahme sowie deren „Eignung und Erfolgsaussichten“. Hierzu muss sich der Arzt verhalten. Allgemein gilt dabei wiederum, „dass sich die Art und Weise sowie Umfang und Intensität der Aufklärung nach der jeweiligen konkreten Behandlungssituation richten“ [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24]. Dabei sind die folgenden Aspekte in jedem Falle zu beachten, während über eine Operationserweiterung oder den Wechsel in eine andere Operationsmethode bzw. -technik bloß aufzuklären ist, wenn sie nicht bloß abstrakt-theoretischer Natur sind, sondern vielmehr ernsthaft in Betracht kommen können [BGH, Urt. vom 21. November 2023 – Az.: VI ZR 380/22], und zwar bereits ex ante im Moment der Aufklärung über die Operation, bei der es ex post zur Erweiterung kommt, ohne die damit verbundenen Aspekte an dieser Stelle weiter vertiefen zu wollen und zu können. Praktisch relevanter ist dagegen die Frage nach möglichen Behandlungsalternativen. Aber der Reihe nach.
Unter dem Aspekt der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Maßnahme gibt es relativ wenig Aufklärungsbedarf, wenn sie absolut indiziert ist. Wenn sie dagegen bloß relativ indiziert ist, gebietet es die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts von Patienten, dass sie darauf hingewiesen werden, dass und mit welchem Risiko ein Aufschieben oder Unterlassen des – zumeist chirurgischen – Eingriffs möglich ist [BGH, Urt. vom 18. März 2003 – Az.: VI ZR 266/02]. Gemäß § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB ist ebenfalls über die „Erfolgsaussichten“ aufzuklären. Statistische Angaben dazu braucht der Arzt freilich nicht zu machen. Überhaupt kann er sich in dieser Hinsicht kurzfassen, solange nicht das Misserfolgsrisiko hoch und/oder die Indikation zweifelhaft ist [BGH, Urt. vom 21. Oktober 2014 – Az.: VI ZR 14/14]. Von solchen Fällen abgesehen muss er Patienten lediglich vermitteln, dass eine günstige Heilungsprognose besteht, ggf. sogar bloß nonverbal, solange nicht medizinische Zweifel insofern angebracht sind.
b) Behandlungsalternativen
Schlussendlich kommt es mit einer gewissen Regelmäßigkeit vor, dass es mehrere medizinische Heilmethoden zur Behandlung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden gibt. In solchen Fällen entspricht es ständiger Rechtsprechung, dass die Wahl der Behandlungsmethode primär Sache des Arztes ist. Als Korrektiv zur ärztlichen Therapiefreiheit, die Ärzten grundsätzlich ein weites Ermessen eröffnet, und zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten ist aber seine Unterrichtung über alternative Behandlungsmöglichkeiten vonnöten, wenn für eine medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie mehrere gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des Patienten führen oder unterschiedliche Risiken und Erfolgsaussichten bieten [BGH, Urt. vom 15. März 2005 – Az.: VI ZR 313/03]. Nachdem das Patientenrechtegesetz „die bisherigen richterrechtlich entwickelten Grundsätze des Arzthaftungs- und Behandlungsrechts gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in einem neuen Untertitel »Behandlungsvertrag« kodifiziert“ hat [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 9], hat diese Rechtsprechung Eingang in § 630e Abs. 1 Satz 3 BGB gefunden.
Danach ist bei der Aufklärung von Patienten „auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.“ Dies gilt insbesondere im Verhältnis einer konservativen Therapie zum chirurgischen Eingriff. Solange ein Zuwarten mit der Operation medizinisch vertretbar ist, muss der Arzt darauf hinweisen, dass sie bloß relativ indiziert ist und stattdessen eine konservative Therapie begonnen bzw. fortgesetzt werden kann. Weil der Patient in solchen Fällen eine echte Wahlmöglichkeit hat, verlangt die Rechtsprechung, dass er zur Wahrung seines Selbstbestimmungsrechts durch die gebotene vollständige ärztliche Belehrung in die Lage versetzt werden muss, eigenständig zu entscheiden, auf welchem Weg die Behandlung erfolgen soll und in welchem Zeitpunkt er sich auf welches Risiko einlassen will [BGH, Beschl. vom 17. Dezember 2003 – Az.: VI ZR 230/12]. Umgekehrt muss er davon abraten, eine konservative Therapie fortzusetzen, wenn sie einen ungünstigen (Heilungs-)Verlauf nimmt, und stattdessen einen Therapiewechsel vorschlagen [BGH, Urt. vom 15. März 2005 – Az.: VI ZR 313/03]. Auf diese Weise werden ärztliche Therapiefreiheit und Patientenautonomie angemessen austariert.
§ 630e Abs. 1 Satz 3 BGB spricht davon, dass lediglich auf „übliche Methoden“ hinzuweisen ist, die alternativ zur vorgeschlagenen Maßnahme möglich sind. Dazu ist der Arzt von sich aus verpflichtet. Auf andere „therapeutische Verfahren, die sich erst in der Erprobung befinden und damit noch nicht zum medizinischen Standard rechnen, muss der Arzt den Patienten allerdings nicht ungefragt aufklären, selbst wenn sie an sich als Therapiealternativen in Betracht kämen“ [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24]. Im Einzelfall kann der Einsatz von sog. Neuland- bzw. Außenseitermethoden medizinisch aber durchaus sinnvoll sein. Er darf – und sollte – etwa erfolgen bzw. zumindest erwogen werden, wenn die verantwortliche medizinische Abwägung und ein Vergleich der zu erwartenden Vorteile dieser Methode und deren abzusehenden und zu vermutenden Nachteile mit der standardgemäßen Behandlung unter Berücksichtigung des Wohles des Patienten die Anwendung der neuen Methode rechtfertigt [BGH, Urt. vom 15. Oktober 2019 – Az.: VI ZR 105/18]. Maßstab dafür wiederum, ob es zur Anwendung einer Behandlungsmethode außerhalb des medizinischen Standards kommt, ist die erforderliche Sorgfalt eines vorsichtigen Arztes [BGH, Urt. vom 22. Mai 2007 – Az.: VI ZR 35/06]. Für individuelle Heilversuche mit einem bislang noch nicht zugelassenen Medikament (sog. Off-Label-Use) hat die Rechtsprechung vergleichbare Grundsätze aufgestellt [BGH, Urt. vom 27. März 2007 – Az.: VI ZR 55/05]. Darüber hinaus bürdet sie Ärzten beim Einsatz von neuen medizinischen Behandlungsmethoden gesteigerte Aufklärungspflichten auf, über die demnächst an dieser Stelle informiert wird, wenn es um die sog. Risikoaufklärung geht.
Wird fortgesetzt.
Verfasser: Prof. Dr. iur. Matthias Krüger, München
matthias.krueger@jura.uni-muenchen.de
| März 2025 |
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz