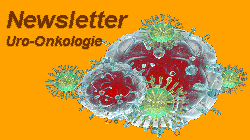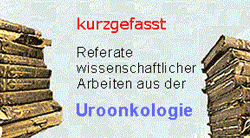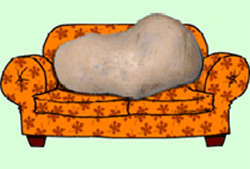Medizinrecht
Patientenrechte: Materielle Aufklärungsaspekte – Ausgangspunkt
In früheren Beiträgen ging es um formelle Aspekte der Aufklärung von Patienten, nun stehen an dieser Stelle und in den nächsten Folgen deren inhaltlichen Anforderungen im Fokus, bei denen von Rechts wegen nicht zwischen Privat- und Kassenpatienten unterschieden werden darf (§76 Abs. 4 SGB V). Dabei geht es zunächst um allgemeine Aspekte, um damit den Boden zu bereiten für künftige Überlegungen zur Eingriffs- und Risikoaufklärung.
I. Einleitung
Das sog. Patientenrechtegesetz hat Ärzten, Patienten und Juristen im Frühjahr 2013 erstmals eine gesetzliche Regelung des Arzt-Patienten-Verhältnisses in §§630a ff. BGB beschert, deren Ziele in den Motiven des Gesetzes nachzulesen sind [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 9]. Orientiert am „Leitbild des mündigen Patienten“ soll es „Patienten und Behandelnde auf Augenhöhe bringen“ und dabei wiederum „einen wesentlichen Beitrag zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit“ leisten, indem es „das Recht für die Patientinnen und Patienten klarer und übersichtlicher“ regelt, damit sie „ihre wichtigsten Rechte möglichst selbst im Gesetz nachlesen können.“ Daran mangelte es nämlich bis dato, weil das Arzthaftungsrecht im Wesentlichen auf Richterrecht beruhte.
Mit seiner gesetzlichen Regelung soll zugleich eine „Signalwirkung […] von verbindlichen gesetzlich festgelegten Rechten und Pflichten“ verbunden sein. Der Rechtsprechung verbleibt „aber weiterhin genügend Spielraum, um im Einzelfall zu ausgewogenen sach- und interessengerechten Entscheidungen zu kommen.“ Zugleich betonte der Gesetzgeber noch, dass man mit dem Gesetz „die bisherigen richterrechtlich entwickelten Grundsätze des Arzthaftungs- und Behandlungsrechts gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in einem neuen Untertitel »Behandlungsvertrag« kodifiziert“ hat.
1. § 630e BGB als Zentralnorm
Dies gilt etwa für den sog. informed consent, zu dem es vom BGH erst Ende 2022 wieder hieß [BGH, Urt. vom 20. Dezember 2022 – Az.: VI ZR 375/21]: „Der Gesetzgeber hat die Einwilligung des Patienten in §630d BGB geregelt. Danach ist der Behandelnde verpflichtet, vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Gemäß §630d Abs. 2 BGB setzt die Wirksamkeit der Einwilligung voraus, dass der Patient […] nach Maßgabe von §630e Abs. 1 bis 4 BGB aufgeklärt worden ist. In §630e BGB sind die vom Senat entwickelten Grundsätze zur Selbstbestimmungsaufklärung kodifiziert worden. Diese Grundsätze gelten inhaltlich unverändert fort […].“ Damit kann festgehalten werden, dass die Einwilligung in einen ärztlichen (Heil-)Eingriff einer korrekten Aufklärung bedarf und die Anforderungen dafür, die zuvor von der Rechtsprechung entwickelt worden sind, nunmehr und in der Sache unverändert in §630e BGB gesetzlich kodifiziert sind, dessen gesetzliche Überschrift nicht von ungefähr „Aufklärungspflichten“ lautet.
Dabei wiederum sind die materiellen bzw. inhaltlichen Anforderungen an eine korrekte Patientenaufklärung in §630e Abs. 1 BGB loziert, der als Grundsatz statuiert, dass der Behandelnde „den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären“ hat (§630e Abs. 1 Satz 1 BGB). Dazu gehören gemäß § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB „insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie.“ Des Weiteren ist noch gemäß § 630e Abs. 1 Satz 3 BGB „auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.“
Wenn man sich dieser Systematik von § 630e Abs. 1 BGB näher widmet, wird deutlich, dass § 630e Abs. 1 Sätze 2 und 3 BGB – im Verhältnis zum in §630e Abs. 1 Satz 1 BGB lozierten Grundsatz – eher deklaratorischer bzw. beispielhafter Natur sind. Es folgt für §630e Abs. 1 Satz 2 BGB aus dem einleitenden Wort „Dazu“ sowie aus seiner beispielhaften und damit keinesfalls abschließenden Aufzählung („insbesondere“) und für §630e Abs. 1 Satz 3 BGB aus dem Wort „auch“. Für juristische Laien mag es sich dabei zunächst um Wortspielchen im Sinne des von Juristen geliebten und gerne vollführten dogmatischen Glasperlenspiels handeln. Ungeachtet dessen geht es in § 630e Abs. 1 Sätze 2 und 3 BGB aber jedenfalls um spezielle Ausprägungen von §630e Abs. 1 Satz 1 BGB. Sie sind damit als Minimum bei jeder Patientenaufklärung vonnöten und lassen sich insofern in gewisser Weise generalisieren. Von daher kommen im Folgenden mehr oder minder bloß §630e Abs. 1 Sätze 2 und 3 BGB expressis verbis zur Sprache, bei deren Handhabung freilich Besonderheiten im Einzelfall bestehen können und immer darauf zu achten ist, welche (weiteren) Aspekte für den konkreten Patienten „wesentlich“ im Sinne von §630e Abs. 1 Satz 1 BGB sind. Damit wird in den folgenden Überlegungen grundsätzlich vom „Normalfall“ der Aufklärung gemäß §630e Abs. 1 BGB ausgegangen, über den freilich am konkreten Patienten orientierte Besonderheiten nicht vernachlässigt werden dürfen.
2. Verhältnis zu § 630c BGB
Bevor aber näher auf inhaltliche Anforderungen von §630e BGB eingegangen werden kann, muss noch kurz sein Verhältnis zu §630c BGB geklärt werden, der nach seiner gesetzlichen (Teil-)Überschrift „Informationspflichten“ statuiert und gewisse Gemeinsamkeiten mit §630e BGB aufweist. Gemäß §630c Abs. 2 Satz 1 BGB obliegt es Ärzten, „dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Verhandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen.“ Damit ist nach §630c BGB und gleichermaßen nach §630e BGB über die „wesentlichen Umstände“ zu informieren und die anschließende Aufzählung einzelner Umstände in beiden Normen ist bloß deklaratorisch und beispielhaft, aber keinesfalls abschließend („insbesondere“). Dies wirft die Frage nach dem normativen Verhältnis der beiden Vorschriften zueinander auf und ist – zumindest für juristische Laien – suboptimal und einigermaßen irritierend. Aus der Perspektive des informed consent ist aber jedenfalls §630e BGB von zentralerer Bedeutung. Schließlich macht §630d Abs. 2 BGB die Wirksamkeit der Einwilligung nicht von §630c BGB abhängig, sondern vielmehr davon, „dass der Patient […] vor der Einwilligung nach Maßgabe von §630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.“
Unabhängig davon ist es für Ärzte im Grunde aber gleichgültig, weil sie in jedem Falle lege artis aufklären müssen und wollen, ohne dass es dabei für sie ex ante von Relevanz ist, ob sie gerade §630e BGB oder §630c BGB erfüllen bzw. in welchem normativen (Stufen-)Verhältnis beide Vorschriften zueinander stehen. Der genaue juristische Unterschied zeigt sich im Grunde erst ex post, und zwar im Arzthaftungsprozess, weil die Beweisregel des §630h Abs. 2 Satz 1 BGB expressis verbis bloß an §630e BGB, nicht aber an §630c BGB anknüpft, der dagegen eher mit der Beweislastumkehr gemäß §630h Abs. 5 BGB wegen groben Behandlungsfehlers in Verbindung gebracht wird (Stichwort von der therapeutischen Sicherungsaufklärung). Prozessuale Aufklärungsaspekte sind freilich ein Thema für sich, auf das nicht an dieser Stelle, vielleicht aber zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen werden kann. Im weiteren Verlauf steht jedenfalls ausschließlich §630e BGB im Mittelpunkt.
Ebenso wenig soll §630c Abs. 3 BGB zur Sprache kommen: Er regelt die sog. wirtschaftliche bzw. ökonomische Aufklärung, nach der Patienten zu offenbaren ist, dass und wenn sie die Kosten der Behandlung selbst tragen müssen. Die Verletzung dieser wirtschaftlichen Aufklärungspflicht stellt aber nicht in Abrede, dass bei im Übrigen einwandfreier Aufklärung ein wirksamer informed consent vorliegt. Es zeigt sich darin, dass §630d Abs. 2 BGB die Wirksamkeit der Patienteneinwilligung nicht von §630c BGB abhängig macht, sondern vielmehr davon, „dass der Patient […] vor der Einwilligung nach Maßgabe von §630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.“ Daran knüpft der BGH an, wenn er urteilt, dass der Patient nach allgemeinen Grundsätzen die Beweislast dafür trägt, dass er sich bei ordnungsgemäßer Information über die voraussichtlichen Behandlungskosten gegen die in Rede stehende medizinische Behandlung entschieden hätte, ohne dass es insofern zu einer Beweislastumkehr zu seinen Gunsten kommt [BGH, Urt. vom 28. Januar 2020 – Az.: VI ZR 92/19]. Damit steht, soweit es um materielle Aufklärungsaspekte geht, zuvörderst §630e Abs. 1 BGB im Fokus des (weiteren) Interesses, das aber erst in der nächsten Folge gestillt wird.
Wird fortgesetzt.
Verfasser: Prof. Dr. iur. Matthias Krüger, München
matthias.krueger@jura.uni-muenchen.de
| Februar 2025 |
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz