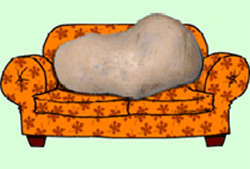Medizinrecht
Patientenrechte: Materielle Aufklärungsaspekte (III) – Eingriffsaufklärung
Das Zentrum der Selbstbestimmungsaufklärung bildet die sog. Risikoaufklärung, d.h. die Information des Patienten über die Risiken des geplanten medizinischen Eingriffs. Sie steht im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen, mit denen die Reihe zu materiellen Aufklärungsaspekten endet.
3. Risikoaufklärung
Nachdem es im vorherigen Beitrag um die sog. Eingriffsaufklärung ging, steht noch die die juristische Aufklärung über die sog. Risikoaufklärung aus, die gerne als Zentrum bzw. Kern der Selbstbestimmungsaufklärung bezeichnet wird. § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB spricht insofern davon, dass „zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme“ zu erläutern sind. Einmal mehr bestimmen sich dabei Umfang und Intensität der Aufklärung nach der jeweiligen Behandlungssituation [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24]. Schließlich hat die Aufklärung patientenbezogen und damit den Umständen des konkreten Einzelfalls entsprechend zu erfolgen [BGH, Urt. vom 18. November 2008 – Az.: VI ZR 198/07]. Ungeachtet dieses variablen bzw. flexiblen Ausgangspunkts gibt es gleichwohl in jedem Fall zu beachtende Ausgangsprämissen, an denen sich Umfang und Intensität der Risikoaufklärung orientieren können, darunter die Frage nach der diesbezüglichen Relevanz medizinischer Statistiken. Im Übrigen gibt es gewisse Besonderheiten der Risikoaufklärung bei Diagnosemaßnahmen sowie bei den Korridor des medizinischen Standards verlassende Behandlungskonzepte (sog. Außenseiter- bzw. Neulandmethoden). Aber der Reihe nach.
Sinn und Zweck der Selbstbestimmungsaufklärung besteht wiederum darin, dem Patienten die Schwere und Tragweite eines etwaigen Eingriffs zu verdeutlichen, damit er eine ausreichende Entscheidungsgrundlage für die Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts erhält. Dabei obliegt es Ärzten aber nicht, medizinisches Detailwissen zu vermitteln [Bundestags-Drucksache 17/10488 S. 24]. Dies entspricht der Rechtsprechung, wonach der Patient nicht exakt in einem medizinischen Sinne informiert werden muss, nach der Aufklärung aber jedenfalls „im Großen und Ganzen“ wissen muss, worin er einwilligt [BGH, Beschl. vom 16. August 2022 – Az.: VI ZR 342/21]. Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Vorbemerkungen kann sich nunmehr Fragen der Eingriffsaufklärung zugewandt werden. Wenn dabei – und demnächst bei der Risikoaufklärung – zuvörderst Entscheidungen zu anderen medizinischen Fachdisziplinen zur Sprache kommen, ist es unschädlich, weil jedenfalls das juristische Haftungsregime identisch ist und die Entscheidungen damit entsprechend übertragbar sind.
a) Ausgangsprämissen
Sinn und Zweck der Risikoaufklärung ist es, den Patienten über nicht ganz außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende Risiken zu informieren, soweit sie für seine Entscheidung für oder gegen den Eingriff von Bedeutung sein können. Er muss eine allgemeine Vorstellung von der Schwere des Eingriffs und den damit spezifisch verbundenen Risiken vermittelt bekommen, ohne sie zu beschönigen oder zu verschlimmern [BGH, Urt. vom 19. Oktober 2010 – Az.: VI ZR 241/09]. Dafür wiederum ist eine Relation anzustellen: Der Aufklärungsumfang wird einerseits bestimmt durch das Gewicht der medizinischen Indikation, das sich wiederum aus der Notwendigkeit des geplanten Eingriffs (absolut versus relativ), seiner zeitlichen Dringlichkeit und den Heilungschancen ergibt, und andererseits durch die Schwere der Schadensfolgen für die Lebensführung des konkreten Patienten im Fall der Risikoverwirklichung [BGH, Urt. vom 18. November 2008 – Az.: VI ZR 198/07]. Auf Basis dieser Aspekte ist eine Nutzen-Risiko-Relation anzustellen, die wiederum Umfang und Intensität der Aufklärung präjudiziert.
Ebenso ist bei Diagnosemaßnahmen zu verfahren [BGH, Urt. vom 18. November 2008 – Az.: VI ZR 198/07]: Wenn sie dringend und vital oder zumindest bedingt vital indiziert sind, ist im normalen Umfang über die damit verbundenen Risiken aufzuklären, sprich Patienten ist eine allgemeine Vorstellung von der Schwere des Eingriffs und den damit spezifisch verbundenen Risiken zu vermitteln, ohne sie zu beschönigen oder zu verschlimmern. Ansonsten ist – insbesondere bei diagnostischen Maßnahmen ohne therapeutischen Eigenwert – diagnostischem Perfektionismus oder sogar wissenschaftlicher Neugier vorzubeugen. In solchen Fällen bedarf es vielmehr einer besonders sorgfältigen Abwägung zwischen der diagnostischen Aussagekraft (etwa beim PSA-Test), den Klärungsbedürfnissen und den besonderen Risiken für Patienten. Im Ergebnis unterscheidet sich die Risikoaufklärung über eine diagnostische Maßnahme damit nicht wesentlich von der über einen therapeutischen Heileingriff.
Nicht erforderlich ist übrigens die exakte medizinische Beschreibung der in Betracht kommenden Risiken. Wenn etwa im Aufklärungsgespräch bzw. -formular auf das (Operations-)Risiko einer „Lähmung“ hingewiesen wird, genügt dies, ohne dass die medizinischen Ursachen dafür erläutert werden müssen, selbst wenn insofern mehrere Szenarien denkbar sind [BGH, Urt. vom 15. Februar 2000 – Az.: VI ZR 48/99]. Ebenso kann grundsätzlich unterstellt werden, dass damit eine dauerhafte Lähmung gemeint ist. Ohne konkrete Anhaltspunkte muss der Arzt dagegen nicht einkalkulieren, dass der Patient damit eine bloß vorübergehende Lähmung impliziert. Es ist vielmehr Sache bzw. Obliegenheit des Patienten, Einzelheiten über Art und Umfang des Lähmungsrisikos zu erfragen [BGH, Urt. vom 11. Oktober 2016 – Az.: VI ZR 462/15]. Dies lässt sich aus § 630c Abs. 1 BGB ableiten, der vorsieht, dass Arzt und Patient bei der Behandlung zusammenwirken sollen, und damit entsprechende Compliance von Patienten zu deren Obliegenheit macht. Freilich kann es nicht schaden, wenn Ärzte den Hinweis auf die (Ir-)Reversibilität solcher gravierenden Risiken von sich aus erteilen.
b) Risikodichte
Im Zusammenhang mit der Risikoaufklärung stellt sich immer wieder die Frage, ob die statistische Wahrscheinlichkeit eines (Operations-)Risikos von Relevanz dafür ist, ob darüber aufgeklärt werden muss. Es entspricht aber der Rechtsprechung [BGH, Urt. vom 19. Oktober 2010 – Az.: VI ZR 241/09], dass die Notwendigkeit zur Aufklärung über ein spezifisch mit der Therapie verbundenes Risiko nicht davon abhängt, mit welcher Häufigkeit es sich realisiert, sog. Komplikationsrate bzw. Risikodichte. Entscheidend ist vielmehr die Bedeutung des Risikos für den konkreten Patienten. Bei einer möglichen besonders schweren Belastung für seine künftige Lebensführung ist er selbst über solche Risiken zu informieren, die sich – statistisch betrachtet – eher sehr selten verwirklichen.
Risikostatistiken mögen ein Indiz für einen aufklärungspflichtigen Umstand liefern, sind im Übrigen aber für das Maß der Aufklärung bloß von geringem Wert und jedenfalls von untergeordneter Bedeutung [BGH, Urt. vom 30. September 2014 – Az.: VI ZR 443/13]. Entscheidend für die ärztliche Hinweispflicht ist nicht ein bestimmter Grad der Risikodichte, insbesondere nicht eine bestimmte Statistik [BGH, Urt. vom 15. Februar 2000 – Az.: VI ZR 48/99]. Vor diesem Hintergrund sollte man sich damit zurückhalten, Patienten genaue oder annährend genaue Prozentzahlen über die Möglichkeit der Verwirklichung eines Behandlungsrisikos mitzuteilen. Ganz im Gegenteil: Wenn sie beim Patienten durch eine unzutreffende Darstellung der Risikohöhe eine falsche Vorstellung über das Ausmaß der mit dem Eingriff verbundenen Gefahren erwecken und dadurch ein – im medizinischen Sinne – verhältnismäßig häufig auftretendes Operationsrisiko verharmlost wird, genügt man seiner Aufklärungspflicht nicht [BGH, Beschl. vom 16. August 2022 – Az.: VI ZR 342/21]. Ebenso wenig haben sich Wahrscheinlichkeitsangaben in Aufklärungsgesprächen bzw. -formularen an den in Beipackzetteln für Medikamente verwendeten Häufigkeitsdefinitionen des Medical Dictionary for Regulatory Activities zu orientieren [BGH, Urt. vom 29. Januar 2019 – Az.: VI ZR 117/18]. Über „selten“ und „gelegentlich“ machen sich Ärzte und Patienten schließlich nicht selten eher unterschiedliche Vorstellungen.
c) Risikokenntnis
Während die Risikodichte für die Aufklärungshaftung bloß von nachrangiger Bedeutung ist, kann die Risikokenntnis dagegen für die Haftung wegen eines Aufklärungsversäumnisses bzw. -mangels von entscheidender Bedeutung sein. Dabei wiederum muss zwischen der Kenntnis auf Patientenseite und dem ärztlichen Wissen um das Risiko differenziert werden. Risikokenntnis auf Patientenseite kann dazu führen, dass die Aufklärung „ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist“ (§ 630e Abs. 3 BGB). Darum geht es an dieser Stelle aber nicht, sondern vielmehr um die Risikokenntnis auf ärztlicher Seite.
Im gesetzlichen Ausgangspunkt schulden Ärzte eine Behandlung „nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards“ (§ 630a Abs. 2 BGB). Deshalb kommt es nicht auf den medizinischen Kenntnisstand zur Zeit des – u.U. erst Jahre später stattfindenden – Arzthaftungsprozesses an, sondern auf den im Zeitpunkt der Behandlung. Der medizinische (Erkenntnis-)Fortschritt zwischen dem streitgegenständlichen medizinischen Eingriff und seiner gerichtlichen Aufarbeitung bleibt damit außen vor. Darauf hat das Gericht übrigens medizinische Sachverständige bei Bedarf hinzuweisen. Der Umfang der Risikoaufklärung und eines diesbezüglichen ärztlichen Verschuldens orientiert sich damit am medizinischen Kenntnisstand im Zeitpunkt der Behandlung.
Vor diesem gesetzlichen Hintergrund ist es bloß folgerichtig, dass der BGH eine Aufklärungspflicht des Arztes bloß für ein solches Risiko anerkennt, das im Zeitpunkt der Behandlung bereits bekannt war. Wenn es dem behandelnden Arzt dagegen nicht bekannt war und ebenso wenig bekannt sein musste, weil es bloß in anderen Spezialgebieten der medizinischen Wissenschaft, nicht aber in seinem Fachgebiet diskutiert wurde, entfällt seine Haftung mangels schuldhafter Pflichtverletzung [BGH, Beschl. vom 29. Mai 2018 – Az.: VI ZR 370/17]. Unmögliches kann selbst das Recht nicht verlangen.
Aber Vorsicht: Wenn sich ein Risiko aus allgemeinen anatomischen Gegebenheiten ableiten lässt (konkret: Querschnittlähmung infolge wirbelsäulennaher Injektion), muss darüber informiert werden. Es handelt sich, selbst wenn es sich bis dahin noch nicht realisiert haben sollte, nicht bloß um ein theoretisches Risiko, sondern aufgrund der anatomischen Verhältnisse um ein konkret denkbares, zumal für die weitere Lebensführung des Patienten gravierendes Risiko, über das aufgeklärt werden muss, damit er es in seine Abwägung einbeziehen kann [BGH, Urt. vom 6. Juli 2010 – Az.: VI ZR 198/09]. Die genaue Grenzziehung lässt sich im Übrigen bloß im jeweiligen Einzelfall aufgrund seiner konkret-individuellen Besonderheiten vornehmen.
Schlussendlich müssen Ärzte, solange es jedenfalls nicht um eine Außenseitermethode geht, keinesfalls darauf hinweisen, dass der Eintritt bislang unbekannter Komplikationen in der Medizin nie ganz auszuschließen ist. Sie sind für die Entscheidungsfindung von Patienten nicht von Bedeutung und würden sie im Einzelfall sogar unnötig verwirren und beunruhigen. Etwas anderes gilt erst, wenn ernsthafte Stimmen in der medizinischen Wissenschaft auf bestimmte mit der Behandlung verbundene Gefahren hinweisen, die nicht als unbeachtliche Außenseitermeinungen abgetan werden können, sondern vielmehr als gewichtige Warnungen angesehen werden müssen [BGH, Urt. vom 13. Juni 2006 – Az.: VI ZR 323/04]. Daraus erklärt sich übrigens der tiefere Sinn der ärztlichen Fortbildungspflicht, deren Vernachlässigung sich in dieser Hinsicht nicht bloß berufsrechtlich, sondern ebenso haftungsrechtlich rächen kann.
d) Außenseitermethoden
Besonderheiten der Risikoaufklärung, es klang bereits subkutan an, bestehen bei (operativen) Neuland- bzw. Außenseitermethoden oder individuellen Heilversuchen mit Arzneimitteln: Im Ausgangspunkt sind die geschilderten Anforderungen an die Risikoaufklärung selbstverständlich nicht geringer, sondern vielmehr ungleich größer. Über bekannte Risiken ist in jedem Falle aufzuklären. Damit hat es sich aber nicht: Es muss ferner überhaupt darauf hingewiesen werden, „dass der geplante Eingriff (noch) nicht medizinischer Standard ist und seine Wirksamkeit statistisch (noch) nicht erwiesen ist“ [BGH, Urt. vom 15. Oktober 2019 – Az.: VI ZR 105/18]. Darüber hinaus muss – anders als bei standardgemäßer Behandlung – darauf aufmerksam gemacht werden, dass unbekannte Risiken derzeit nicht auszuschließen sind [BGH, Urt. vom 27. März 2007 – Az.: VI ZR 55/05]. Die Aufklärung über bekannte Risiken, die sich später beim Eingriff realisieren, heilt übrigens nicht das Unterlassen der gerade geschilderten zusätzlichen Hinweise [BGH, Urt. vom 22. Mai 2007 – Az.: VI ZR 35/06]. Diesen gesteigerten Anforderungen an seine Aufklärungspflicht sollte sich der behandelnde Arzt bewusst sein, wenn er sich zur Anwendung eines nicht allgemein anerkannten, den Korridor des medizinischen Standards verlassenden Behandlungskonzepts entschließt, wozu er sich im Rahmen seiner ärztlichen Therapiefreiheit aber durchaus entschließen darf, solange er als Korrektiv dazu und zur Wahrung der Patientenautonomie den insofern gesteigerten Aufklärungspflichten genügt.
Daneben hat er sich – wegen § 630h Abs. 2 und 3 BGB – um eine ausreichende Dokumentation der zusätzlich erteilten Hinweise zu bemühen, um im Arzthaftungsprozess einigermaßen ausreichend gegen den vom Patienten vielleicht erhobenen Einwand eines Aufklärungs- und/oder Dokumentationsmangels gewappnet zu sein. Damit soll es mit materiellen Aufklärungsaspekten sein Bewenden haben.
Verfasser: Prof. Dr. iur. Matthias Krüger, München
matthias.krueger@jura.uni-muenchen.de
| April 2025 |
© 2003-2025 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz