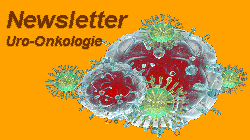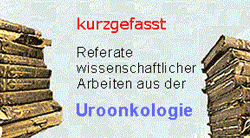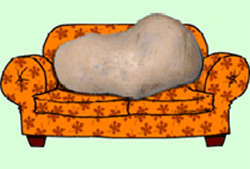Starke Empfehlung für Triple-Therapie mit Darolutamid in Kombination mit ADT + Docetaxel für alle Chemotherapie-geeigneten Patienten
Mit Empfehlungsgrad A und Evidenzlevel 1++ befürwortet die aktualisierte S3-Leitlinie die Triple-Therapie mit Darolutamid plus Docetaxel und ADT für alle Chemotherapie-geeigneten mHSPC-Patienten.
Der Androgenrezeptor-Inhibitor (ARI) Nubeqa® (Darolutamid) ist als Therapieoption sowohl seit 2020 in der Indikation des
nicht-metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms mit hohem Risiko für die Entwicklung von Metastasen (HR-nmCRPC)
als auch seit 2023 beim metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) zugelassen. Die Triple-Therapie beim mHSPC –
bestehend aus Darolutamid in Kombination mit Docetaxel und Androgendeprivationstherapie (ADT) – wird nun auch in der
aktualisierten S3-Leitlinie für Chemotherapie-geeignete Männer mit mHSPC empfohlen [1]. Außerdem bestätigt eine Post-hoc-Analyse
der ARASENS-Studie zum PSA-Ansprechen die Effizienz der Triple-Therapie im mHSPC [2], während neue, vergleichende
Real-World-Daten aus den USA die Effizienz und Verträglichkeit von Darolutamid beim HR-nmCRPC in der täglichen Praxis
untermauern [3].
Empfehlung für alle Chemotherapie-geeignete mHSPC-Patienten
Die aufgrund der positiven Daten bestehende Zulassung von Darolutamid in der Indikation mHSPC spiegelt sich nun auch in
der aktualisierten S3-Leitlinie „Prostatakarzinom“ wider [1]. Hier wurde die Triple-Therapie aus Darolutamid plus Docetaxel und
ADT neu als Therapieoption für alle Chemotherapie-fähigen Patienten – unabhängig von klinischen Subgruppen wie der
Tumorlast und dem Risikostatus –aufgenommen. Die alleinige Zweifachtherapie aus Docetaxel + ADT wird nicht mehr
empfohlen. Bei der SOLL-Empfehlung für Darolutamid als Triple-Therapie handelt es sich um eine starke Empfehlung
mit hohem Evidenzgrad. Die Doublet-Therapien aus ARI plus ADT tragen ebenfalls diesen Empfehlungsgrad, wobei
Darolutamid als einzige ADT-Kombination im mHSPC eine Level-1++-Evidenz erreicht [1].
Tiefes PSA-Ansprechen bekräftigt Effizienz der Triple-Therapie beim mHSPC
Die Triple-Therapie aus Darolutamid in Kombination mit Docetaxel plus ADT wurde in der randomisierten Phase-III-Studie
ARASENS gegen Docetaxel plus ADT als aktivem Komparator verglichen. Insgesamt wurden 1.306 mHSPC-Patienten
eingeschlossen, die sich für eine Chemotherapie eigneten. Unter der Triple-Therapie war das Gesamtüberleben
(OS; primärer Endpunkt) signifikant verlängert, was sich durch ein um 32,5% verringertes Sterberisiko gegenüber
Docetaxel plus ADT äußerte [4]. Außerdem verdoppelte sich die Zeit bis zur Kastrationsresistenz, einem sekundären
Studienendpunkt, ebenfalls signifikant gegenüber dem aktiven Komparator [4]. Die während der Behandlung auftretenden
Nebenwirkungen nahmen durch die zusätzliche Darolutamid-Gabe im Vergleich zu Docetaxel plus ADT nicht in
relevantem Maße zu [4]. Darüber hinaus wurde als explorativer Endpunkt die Zeit bis zur PSA-Progression bestimmt,
welche ebenfalls unter der Triple-Therapie signifikant länger war als unter dem aktiven Komparator [5].
Eine zusätzliche Post-hoc-Analyse untermauert die Effizienz der Kombination in Bezug auf das PSA-Ansprechen. Tatsächlich verdeutlichen die beim ESMO-Kongress 2023 präsentierten und nun im Journal „European Urology“ veröffentlichten Daten [11] sogar, dass die Triple-Therapie das PSA-Ansprechen gegenüber Docetaxel plus ADT unabhängig vom Tumorvolumen deutlich verbesserte [2,6]. So blieben 65,8% mit high volume und 91,7% mit low volume mHSPC über 4 Jahre ohne PSA-Progress, während es unter Docetaxel plus ADT nur 36,3% bzw. 27,0% waren [6]. Außerdem profitierten die mHSPC-Patienten unabhängig von ihrer Risiko-Subgruppe von der zusätzlichen Darolutamid-Gabe, so dass der PSA-Wert unter der Triple-Therapie bei 63,1% (high risk) bzw. 76,9 % (low risk) der Patienten mindestens einmal im Studienverlauf die Nachweisgrenze unterschritt, was unter dem aktivem Komparator lediglich bei 24,1% (high risk) bzw. 39,2% (low risk) gelang [6].
Diese Ergebnisse sind prognostisch relevant, da das Erreichen eines PSA-Werts von <0,2 ng/mL unter der
Triple-Therapie unabhängig von Krankheitslast oder Risikoklassifizierung mit einem verbesserten OS assoziiert war [6].
Folglich erzielte die Triple-Therapie beim mHSPC ein tiefes und anhaltendes PSA-Ansprechen, was sich wiederum
vorteilhaft auf Überleben auswirkte und die Progression verzögerte [2,5]. Insbesondere low-volume-Patienten könnten
von der frühen intensivierten Therapie mit einer annähernden Chronifizierung der Erkrankung in >91% der Fälle
profitieren [6].
Vergleichende Real-World-Studie DEAR bestätigt praktischen Nutzen und Verträglichkeit beim HR-nmCRPC
Die Zulassung von Darolutamid in der Indikation HR-nmCRPC basiert auf der Phase-III-Studie ARAMIS, in der 1.509 ARI-naive
Patienten mit HR-nmCRPC zusätzlich zur ADT entweder Darolutamid oder Placebo erhielten. Während Darolutamid-Patienten
ein medianes metastasenfreies Überleben (MFS) von 40,4 Monaten erreichten, betrug das MFS unter Placebo lediglich
18,4 Monate [7]. Die positive Wirkung von Darolutamid auf das OS schlug sich in einem um 31% gesenkten Sterberisiko
nieder [8]. Auch in Bezug auf die Verträglichkeit sind die ARAMIS-Daten positiv zu bewerten, da potenziell alltagsbeeinträchtigende
Nebenwirkungen unter Darolutamid auf Placebo-Niveau lagen [7,8].
Der praktische Nutzen und die Verträglichkeit von Darolutamid beim HR-nmCRPC wurden nun erstmals auch im
Head-to-Head-Vergleich in der retrospektiven Real-World-Studie DEAR, an der 870 Patienten aus den USA teilnahmen,
bestätigt. Patienten unter Darolutamid brachen in DEAR seltener die initiale Behandlung ab und erlitten seltener ein
Fortschreiten zum mCRPC als unter Enzalutamid oder Apalutamid [3]. Während 30,4% der Darolutamid-Patienten die
initiale Therapie beendeten, waren es unter Enzalutamid 40,8% und unter Apalutamid 46,0%. Nebenwirkungen
stellten den häufigsten Grund für Therapieabbrüche dar; diese traten unter Darolutamid bei 10,2%, unter Enzalutamid
bei 14,4% und unter Apalutamid bei 15,1% der Patienten auf [3]. Auch das Fortschreiten der Erkrankung zum mCRPC
war unter Darolutamid mit nur 17,7% betroffenen Patienten deutlich geringer als unter Enzalutamid mit 28,3% oder
Apalutamid mit 27,8% der Patienten [3]. Um diese vielversprechenden Real-World-Ergebnisse zu untermauern und die
Ergebnisse in anderen Populationen oder anhand anderer Datenquellen zu bestätigen, werden zukünftig dennoch
weitere Studien benötigt.
Referenzen:
[1] Leitlinienprogramm Onkologie, Version 7, Mai 2024. S3-Leitlinie Prostatakarzinom.
[2] Saad F, et al. J Urol. 2023; 209(Suppl 4): e380.
[3] Morgans AK, et al. J Clin Oncol. 2023; 41(Suppl 16): Abstract 5097.
[4] Smith MR, et al. N Engl J Med. 2022; 386(12): 1132-1142.
[5] Saad F, et al. J Clin Oncol. 2022; 40(Suppl 16): Abstract 5078.
[6] Saad F, et al. Ann Oncol. 2023; 34(Suppl 2): S964.
[7] Fizazi K, et al. N Engl J Med. 2019; 380(13): 1235-1246.
[8] Fizazi K, et al. J Clin Oncol. 2020; 38(Suppl 15): 5514.
[9] Fizazi K, et al. Ann Oncol. 2023; 34(6): 557-563.
[10] Saad F, et al. Eur Urol. 2024.
Quelle: Pressemitteilung Bayer
17. Juni 2024
© 2003-2026 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz