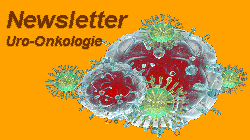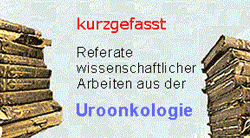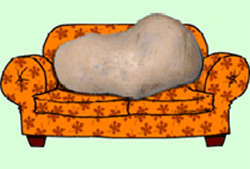Stellenwert der Erhaltungstherapie beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom
Zum 15. Mal fand am 26. November 2022, nach 2 Jahren Corona-Pause, wieder das urologische medac-Symposium in Hamburg statt. Seit 2007 lädt das Unternehmen jedes Jahr niedergelassene Urolog*innen aus Deutschland ein, um über aktuelle Trends und Themen zu diskutieren. Zu diesem Jubiläumsevent konnte medac ein abwechslungsreiches Programm zum nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom bieten. Die ca. 100 anwesenden Urolog*innen genossen die hohe Vortragsqualität und eine anregende Diskussion anhand von Fallbeispielen.
medac als Spezialist rund um die Therapie des nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinoms (NMIBC) präsentierte auf ihrer
CME-zertifizierten Veranstaltung Kongress-News aus dem Jahr 2022 und diskutierte mit den anwesenden Urolog*innen Fragen
aus der täglichen Praxis. Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Dr. Franz von Götz, medac GmbH, übernahm
Prof. Dr. Christian Gratzke, Universitätsklinikum Freiburg, die Moderation des Tages.
Risikoklassifizierung beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom
Im ersten Vortrag thematisierte Prof. Dr. Günter Niegisch, Universitätsklinikum Düsseldorf, die adjuvante
Instillationstherapie beim NMIBC. Eine sorgfältige transurethrale Resektion (TUR) ist ausschlaggebend für eine
erfolgreiche Behandlung. Ebenso relevant allerdings ist die genaue Risikoklassifizierung des Tumors, da sich an
dieser Einschätzung die anschließende Therapieempfehlung der S3-Leitlinie orientiert [1]. Eine eindeutige Zuordnung
in die Risikoklassen, so betonte Niegisch, sei sehr relevant, da sich die Tumore hinsichtlich der Rezidiv- und
Progressionsraten sehr unterschiedlich entwickeln. Im Gegensatz zu den etwas veralteten Daten aus den EORTC-Tabellen
ermöglicht der neue Risikokalkulator der EAU eine gezielte Abschätzung des individuellen Progressionsrisikos nach 1, 5
und 10 Jahren basierend auf aktuellen Datensätzen [2].
Adjuvante Instillationstherapien
Bei low-risk und bestimmten intermediate-risk Patient*innen empfiehlt die EAU-Leitlinie die Durchführung einer
Frühinstillation mit einem Chemotherapeutikum (z.B. Mitomycin) innerhalb der ersten 24 Stunden nach der TUR [3].
Die Chemo-Frühinstillation ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie, da sie einen signifikanten Einfluss auf
die Rezidivrate hat [3]. Intraoperativ kann eine Einstufung in die korrekte Risikogruppe allerdings schwierig sein,
so dass eine Frühinstillation laut Niegisch bei Ausschluss von Kontraindikationen auch unabhängig von der Risikogruppe
möglich sei.
Bei den adjuvanten Instillationstherapien empfiehlt die S3-Leitlinie für intermediate-risk Patient*innen den Einsatz
einer Chemo- oder einer Bacillus Calmette-Guérin (BCG)- Therapie. Bei beiden Therapieoptionen sollte bei diesem
Patientenklientel nach der Initialtherapie unbedingt eine Erhaltungstherapie von einem Jahr durchgeführt werden,
weil dies für den Therapieerfolg ausschlaggebend sei, so Niegisch in seinem Vortrag [4, 5]. Die Wahl, ob Chemo- oder
BCG-Instillationstherapie für intermediate-risk Patienten, sollte basierend auf der individuellen Patientensituation
getroffen werden. Gerade die Verträglichkeit der Therapie könne hierbei ein ausschlaggebender Faktor sein, betonte
der Experte.
Bei den high-risk Patient*innen ist eine BCG-Therapie die Behandlung der ersten Wahl für einen Blasenerhalt. Die
S3-Leitlinie empfiehlt nach der Initialtherapie eine Erhaltungstherapie für die Dauer von mindestens 1 bis höchstens
3 Jahren [1]. Das Progressionsrisiko wird unter BCG-Instillationstherapie um 27% gesenkt, wenn eine Erhaltungstherapie
erfolgt [6]. Neben einer adäquat durchgeführten BCG-Therapie trägt vor allem auch die Qualität der TUR zum Therapieerfolg
bei [7]. Darüber hinaus ist die nachfolgende Therapiekontrolle wichtig: Die S3-Leitlinie empfiehlt für Patient*innen mit
nicht-muskelinvasivem Blasenkarzinom eine konsequente Kontrolle per Zystoskopie und Urinzytologie in regelmäßigen
Intervallen. Der Abstand der Intervalle richtet sich nach der Risikogruppe.
Therapie bei einem Rezidiv nach einer BCG-Therapie
Um den weiteren Therapieverlauf nach dem Auftreten eines Rezidivs während oder nach einer BCG-Therapie zu entscheiden,
macht es laut Niegisch Sinn, die Patient*innen in 3 Gruppen einzuteilen: BCG-Relapse, BCG-Refraktär und BCG-Intolerant.
Für jede Gruppe ergibt sich eine entsprechende weitere Therapieempfehlung. Bei der BCG-Relapse-Gruppe kann eine
Fortführung mit BCG oder eine alternative Instillationstherapie durchaus sinnvoll sein, während bei einer BCG-Refraktärität
oder -Intoleranz eher eine Zystektomie in Erwägung gezogen werden sollte.
Frühzystektomie – Wann macht es Sinn?
Im anschließenden Vortrag spricht PD Dr. Markus Grabbert vom Universitätsklinikum Freiburg darüber, wann eine Frühzystektomie bei Patient*innen mit NMBIC sinnvoll ist und welche Alternativen zur Verfügung stehen.
Die EAU-Leitlinie bewertet zur Einteilung der high-risk Patient*innen außer dem Tumorstadium und dem histologischen
Grading 3 weitere Parameter: Alter über 70 Jahre, multiple papilläre Tumore und ein Tumor größer als 3 cm. Aus dieser
Einteilung ergibt sich die ergänzende Risikogruppe der very high-risk Patient*innen. Bei diesen Patient*innen ist die
Progressionswahrscheinlichkeit besonders hoch und eine radikale Zystektomie stellt die zu bevorzugende Therapieoption dar.
Eine BCG-Therapie kann erwogen werden, wenn eine radikale Zystektomie nicht in Frage kommt [3]. Ein weiterer Grund eine
Zystektomie zu empfehlen, ist das Versagen einer primären BCG-Therapie, da dies mit einem hohen Risiko für Progression
und entsprechender tumorbedingter Mortalität assoziiert ist.
Alternativen zur radikalen Zystektomie
Eine Zystektomie ist eine Therapie mit hoher onkologischer Effektivität für das NMBIC, die allerdings mit einer relevanten
Komplikationsrate (Morbidität und Mortalität) [8] und hohen Raten von Harninkontinenz [9] mit entsprechender Einschränkung
der Lebensqualität einhergehen kann. Aus diesem Grunde wird immer weiter an Alternativen geforscht, wie zum
Beispiel der HIVEC (Hyperthermie)-Therapie mit einem Chemotherapeutikum [10], der trimodalen Therapie [11] oder einer
immunonkologischen Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren [12].
Fazit
Die S3-Leitlinie empfiehlt für high-risk nicht-muskelinvasive Blasenkarzinome bei einer Instillationstherapie mit
BCG unbedingt eine Erhaltungstherapie für mindestens 1 und höchstens 3 Jahre, um den bestmöglichen Therapieerfolg
zu erzielen [1, 5, 13].
In der Praxis ist eine Erhaltungstherapie über 3 Jahre aufgrund von Unverträglichkeiten nicht
bei allen Patient*innen möglich [13]. Um die Therapie trotzdem so lange wie möglich beizubehalten, kann es helfen,
die Patient*innen gut über den Nutzen als auch über die möglichen Nebenwirkungen einer BCG-Therapie aufzuklären,
Fragen der Patient*innen zu beantworten und sie regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen zu motivieren.
Bei intermediate-risk Patient*innen ist bei Nutzung von BCG eine Erhaltungstherapie über 1 Jahr ausreichend [3, 5].
Eine Chemotherapie-Instillation (z.B. mit Mitomycin) kann bei diesem Patientenklientel gegenüber BCG den Vorteil
einer besseren Verträglichkeit bringen [3, 14]. Dies hängt von der individuellen Patientensituation ab. Der
Initialtherapie sollte sich aber auch bei einer Chemo-Instillationstherapie eine Erhaltungstherapie anschließen [3, 4, 15].
Literatur:
[1] S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms 2.0; Leitlinienprogramm Onkologie
(Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF); März 2020:
https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/harnblasenkarzinom
[2] Sylvester et al. Eur Urol. 2021 Apr;79(4):480-488.
[3] Babjuk M et al. European Association of Urology Guidelines on Non-muslce-invasive Bladder Cancer (TaT1 and cis),
2022 Update:
https://uroweb.org/guidelines/non-muscle-invasive-bladder-cancer/chapter/disease-management
[4] Huncharek et al. J Clin Epidemiol. 2000 Jul;53(7):676-80.
[5] Oddens et al. Eur Urol. 2013 Mar;63(3):462-72.
[6] Sylvester et al. J Urol. 2002 Nov;168(5):1964-70.
[7] Guevara et al. J Urol. 2010 Jun;183(6):2161-4.
[8] Schulz et al. Clin Genitourin Cancer. 2018 Dec;16(6):e1141-e1149.
[9] Hautmann et al. J Urol. 2021 Jan;205(1):174-182.
[10] Pijpers et al. Urol Oncol. 2022 Feb;40(2):62.e13-62.e20.
[11] Ding et al. Front Oncol. 2020 Oct 14;10:564779.
[12] Balar et al. Lancet Oncol. 2021 Jul;22(7):919-930.
[13] Lamm et al, European Urology Supplements,Volume 9, Issue 9, 2010, Pages 715-734.
[14] Schmidt et al. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan 8;1(1):CD011935.
[15] Laukhtina et al.; Eur Urol Focus. 2022 Mar;8(2):447-456
Quelle: medac GmbH
www.medac.de
| 03. Januar 2023 |
© 2003-2026 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz